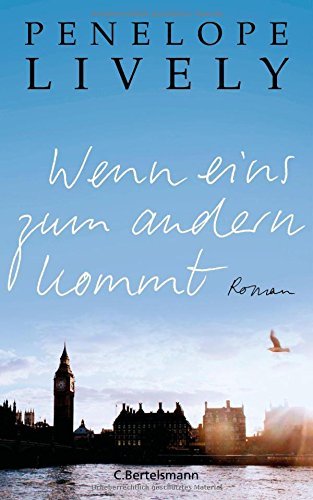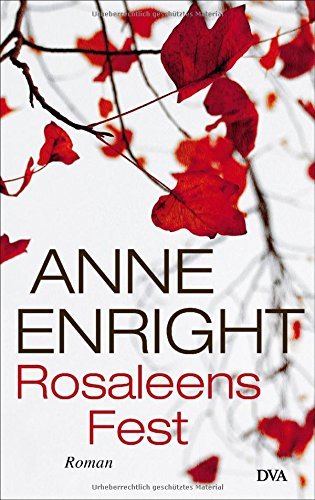Trivialitäten aus der Werkstatt des Todes
Wir ziehen in den Südwesten! Diese Botschaft brachten im Sommer 1943 etwa zwei Dutzend amerikanische Angestellte mit nach Hause. Der Umzug war vom Arbeitgeber angeordnet – der US-Regierung. Die Männer waren hochqualifizierte und spezialisierte Wissenschaftler, ihr Auftrag ambitioniert, von welthistorischer Bedeutung und dringend: eine funktionsfähige Atombombe zu entwickeln, ehe feindliche Mächte ihnen zuvorkommen und die USA damit bedrohen konnten. Mit dieser Waffe in Händen würden die Amerikaner Nazis und Japaner in die Knie zwingen, den Weltkrieg beenden, Stalin in Schach halten und sich als führende Weltmacht etablieren können. Der Preis, den die Bevölkerung im Gebiet eines Einsatzes würde bezahlen müssen, musste der Regierung und den Forschern klar sein: hunderttausendfacher Tod, schwerste Verstümmelungen, Leid und Zerstörung.
Wie dieser Auftrag manchen Beteiligten zusetzte, welche Kämpfe sie mit sich selbst und den Kollegen ausfechten mussten, um einen Weg zu finden zwischen moralischen, religiösen, philosophischen und humanistischen Prinzipien, wissenschaftlichem Ethos, persönlicher Verantwortung, Loyalität zu ihrem Land und seinen strategischen und politischen Zielen, das haben zahlreiche Autoren und Künstler vielfältig und differenziert bearbeitet (Zusammenstellungen beispielsweise in den Wikipedia-Artikeln zum »Manhattan-Projekt« und zu »Robert Oppenheimer«, dem Leiter des Projekts).
Nun hat die junge amerikanische Schriftstellerin TaraShea Nesbit ihr Romandebüt einem bislang unbeachteten Aspekt dieser schwierigen Phase der Historie gewidmet. In »The Wives of Los Alamos«  (Übersetzung: Barbara Schaden) erzählt sie, wie die Ehefrauen der Wissenschaftler die Zeit in der Forschungsenklave erlebten.
(Übersetzung: Barbara Schaden) erzählt sie, wie die Ehefrauen der Wissenschaftler die Zeit in der Forschungsenklave erlebten.
Wohin es gehen soll, was sie dort erwartet, davon haben die anfangs nur wenigen jungen Frauen keine Ahnung. Sie steigen in Sante Fé, New Mexico, aus dem Zug, dann werden sie nebst ihren Säuglingen und Kleinkindern in Bussen weiterverfrachtet, bis sie schließlich mitten in der Wüste ihr Ziel erreichen: »Site Y« bei Los Alamos, auf keiner Landkarte markiert, keine Schule, kein Krankenhaus. Hektisch stampfen hier Armeeeinheiten eine schlichte Siedlung aus dem Boden – Wellblechbaracken, identische olivgrüne Holzhäuschen, Stacheldraht um das gesamte Areal, Zugang nur für authorisierte Personen. Die Labore und Werkstätten der Ehemänner liegen noch weiter abgesondert in der einige Meilen entfernten Tech Area. Woran sie dort arbeiten, weiß niemand. Fragen werden nicht beantwortet. Für jeden, der hier lebt, gilt die höchste Geheimhaltungsstufe.
Die Frauen haben die verschiedensten Hintergründe. Einige sind erst kürzlich eingewandert, die meisten haben einen akademischen Abschluss. Etliche haben in Yale oder Harvard promoviert. Dazu die charakterlichen Unterschiede. Wenngleich Reibereien, Missgunst und Rivalitäten in der Zwangsgemeinschaft nicht ausbleiben, sitzen alle im selben Boot. Weit weg von ihren bisherigen sozialen Umfeldern und von der Zivilisation sind sie in ein trostlos uniformes Lager verbannt, wo sie sich auf dem Abstellgleis fühlen. Während die Männer pausenlos im Dienst sind, bleibt den Frauen nicht viel zu tun als sich, unterstützt von mexikanischen Hausmädchen, dem überschaubaren Haushalt und der Erziehung der Kinder zu widmen, sich als Sekretärinnen zu bewerben oder Post auszutragen. Eine kleine Elite forscht Seite an Seite mit den Männern in der Tech Area. Alle müssen sich irgendwie mit den extremen klimatischen Gegebenheiten, glühend heißen Tagen und eisigen Nächten, Dürreperioden und starken Regenfällen, Staub und Schlamm, Wasser- und Lebensmittelrationierung arrangieren.
Mit der Zeit entdeckt man, dass die surreale Situation einer Art Gefangenschaft auf Zeit auch Schönes bietet. Die Landschaft ist keineswegs bloß eine öde Wüste, wie befürchtet, sondern grandios und abwechslungsreich. In der näheren und weiteren Umgebung locken wunderschöne Szenerien mit idyllischen Canyons, uralten Höhlensiedlungen, Bergwiesen, Wildbächen – genug Ziele für Picknicks und Barbecues, für Ausritte und zum Skifahren.
Um die eigentümliche Befindlichkeit ihrer Protagonistinnenkommune zu verdeutlichen, wählt die Autorin eine ungewöhnliche Erzählperspektive. Anstatt eine der Frauen als repräsentatives Sprachrohr zu profilieren oder episodenweise mal aus dieser, mal aus jener Sicht zu berichten, spricht sie konsequent von »wir« und meint damit das gesamte Kollektiv: »Wir waren mehr als nur Ich, wir waren Wir, [...] obwohl wir uns Einzigartigkeit wünschten.« In der Gemeinschaft sind sie stark, können »den Stadtrat organisieren« und, »bewaffnet mit Babyfläschchen und Konservendosen«, Forderungen nach einem größeren Einkaufsladen durchsetzen.
Was alle Frauen im »Wir« verbindet, sie unisono erzählen lässt, ist neben räumlicher Isolation und Einsamkeit das schwer lastende Bewusstsein, an einer Entwicklung von gewaltiger Bedeutung beteiligt und gleichzeitig von ihr ausgeschlossen zu sein. Die anfängliche Ahnungslosigkeit wird durch systematische Geheimnistuerei festgeschrieben. Die Frauen bereiten ihren Männern ein Zuhause, empfangen sie, wenn sie mit »wirrer Miene« nach Hause kommen, und hören zu, wenn sie im »Wissenschaftskauderwelsch« fachsimpeln, können aber nicht teilhaben, nicht einmal Fragen stellen. So tragen sie nolens volens zur Entstehung von etwas bei, das die Männer nur als »The Gadget« bezeichnen, von dem die Frauen jedoch nicht einmal wissen, »was es wirklich war, dieses ›Gerät‹«.
Der brutalen Wahrheit am nächsten kommt, wer in der Nacht zum 16. Juli 1945 aufbleibt und den Horizont beobachtet. Ausgerüstet mit Schinkensandwichtüten und Thermoskannen sind viele der Männer gemeinsam ins Wochenende aufgebrochen, als ginge es zum Pfadfinder-Hike durch die Wüste. Aber am frühen Morgen bebt die Erde. In der Ferne entfaltet sich ein gewaltiger Pilz, »eine riesige Qualle ... purpurrot«. Bei ihrer Rückkehr sind die Männer begeistert und erschöpft. Hautverbrennungen und Augenreizungen deuten nur sanft an, was für ein Höllenfeuer sie zu zünden gelernt haben, während ihre Frauen die Kinder hegten und sich mit Lesekreisen, Strickrunden, Tanzabenden Abwechslung verschafften.
Nachdem das Geschöpf ihrer Männer drei Wochen später seiner Bestimmung gemäß über Hiroshima und Nagasaki abgeworfen worden war, erfüllte es auch seinen politischen Zweck. Der Feind war schwer verwundet, zerstört, demoralisiert und besiegt, der Zweite Weltkrieg ging zu Ende. Spätestens jetzt musste sich auch jede der Frauen von Los Alamos damit auseinandersetzen, ob »The Gadget« ein Wunderwerk oder ein Albtraum war und welchen Beitrag sie dazu geleistet hatte.
Auch zu TaraShea Nesbits Roman stellen sich etliche Fragen. Die grundsätzlichste lautet: Welche Relevanz haben die trivialen Alltagserlebnisse einer gut situierten Frauengemeinschaft, die sich nur über die schlichte Tatsache definiert, dass ihre Ehegatten eine epochale Tätigkeit ausüben? Zur ebenso interessanten wie problematischen Forschungsarbeit können sie nur Mutmaßungen äußern. Neben dem, was in der Tech Area geschieht, wirken die im Roman fokussierten Aktivitäten und Befindlichkeiten in den Küchen, Kinder- und Wohnzimmern erst recht unbedeutend.
Nesbits Versuch, eine funktional angemessene neue Erzählperspektive zu installieren, führt anfangs zu einigem Befremden. Das permanente »Wir« wirkt ziemlich gezwungen und künstlich (»[Der Besucher] fragte unsere Männer nach ihrer Forschungsarbeit ... sie gingen miteinander durch den Flur zum Arbeitszimmer unseres Mannes.«).
Hauptsächlich dient die Erzählperspektive der Verharmlosung. Sie erschafft eine kollektive Distanz zum Wirken der Physiker und Techniker in den Laboren. Die dortigen Anstrengungen, eine unerhörte Todesmaschine zu entwickeln, laufen jenseits der Bühne der Frauengeschichten ab und bleiben hinter Andeutungen versteckt. Stattdessen wird uns Belangloses, Klatsch und Tratsch aufgetischt: »Mrs Oppenheimer hatte am Dienstag beim Frühstück eine Fahne.« Die Frauen nennen ihre kleine, stetig wachsende Stadt »Shangri-La« – ein geradezu zynischer Widerspruch zur realen Funktion dieses Ortes.
Die Selbstbeschränkung auf eine Perspektive mit verschleierter Sicht verhindert den Zugang zu den realen Personen und historischen Geschehnissen. Die Männer bleiben so schemenhaft, wie es ihre Arbeit für die Frauen war. Berühmte Verantwortungsträger wie Robert Oppenheimer, Niels Bohr und Enrico Fermi huschen als bloße Numen über die Seiten. Wichtige Zeitereignisse (Brandbomben auf Dresden, Mussolini hingerichtet, Selbstmord Hitlers) dringen nur als Radionachrichten in die abgeschottete kleine Welt der Frauen von Los Alamos.
Darüber hinaus halte ich das Konzept einer Kollektivierung grundsätzlich für fragwürdig. Selbst die Autorin kann natürlich nicht umhin, die Unterschiede zwischen den Frauen immer wieder auszuspielen, auch wenn die Individualisierung sich meist auf Vornamen und einfache Etikettierungen beschränkt (»Virginia sprach über ihre Liebe zu Irland. Mildred sorgte dafür, dass der Whiskey die Runde machte. Evelyn trug diesmal den purpurnen Tirolerhut ...«).
Das Erzählen ist nach Jahren (1943 bis 1945) und Schlagwörtern (»Ausflüge«, »Vorwürfe«, »Der Direktor« ...) grob strukturiert. De facto ergibt sich ein Themen-, Chronologie- und Lokalitäten-Hopping zwischen 1943 und 1968, Los Alamos und Vietnam, der Entwicklung der Atombombe und der Friedensbewegung. Ein konsistenter Handlungsfluss bleibt aus. Ärgerlicher sind die ständigen inhaltlichen Wiederholungen bei Alltagsroutinen, Kindererziehung, Klatsch und Tratsch am Kochtopf.
Fazit: Ein nicht uninteressantes, aber insgesamt seichtes, weithin überflüssiges Buch.
 · Herkunft:
· Herkunft: