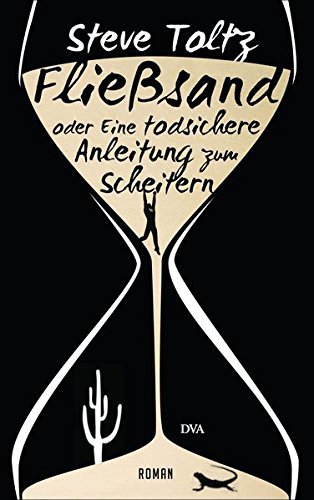Keine Hoffnung auf Besserung?
Was Toni Morrison, Literaturnobelpreisträgerin des Jahres 1993, in ihrem Roman »Gott, hilf dem Kind« erzählt, verstört zutiefst. Man gewinnt den Eindruck, dass sich in sieben, acht oder mehr Jahrzehnten nichts, aber auch gar nichts verändert habe, als sei die amerikanische Bürgerrechtsbewegung der Sechzigerjahre folgenlos verklungen, als sei Barack Obamas Präsidentschaft nicht die Spitze eines Eisbergs, sondern nur eine Seifenblase gewesen, bis sein hemdsärmelig-plumper Nachfolger sie per Dekret platzen lässt und die alten Ungerechtigkeiten verewigt. Muss man jetzt nicht befürchten, dass auch noch die letzten dünnen Firnisschichten von Anstand, die Amerikas Schwarze geschützt haben mögen, achtlos weggewischt werden?
Wir lesen von Menschen, die durch Rassenhass, Missbrauch, Gewalt, Verrat und Ausbeutung seelisch verformt oder verkrüppelt sind. Da sie keine Alternativen kennengelernt haben, tragen sie die Ursachen ihres Leids selbst weiter und erzeugen, selbst wenn sie nach Liebe suchen, neues Leid bei ihren Mitmenschen, auch bei den ihnen am nächsten Stehenden. Die Autorin gönnt zwar zwei ihrer Protagonisten ein mildes Happy End, aber einen Weg aus dem Teufelskreis kann das nicht aufzeigen.
Die Ereignisse des dreiteiligen Romans werden aus den alternierenden Perspektiven von fünf Frauen erzählt: Sweetness, Bride (ihre Tochter), Brooklyn (Brides beste Freundin), Sofia (Brides Lehrerin) und das Mädchen Rain. Einzig die Geschichte von Booker (einem Freund Brides) und seinem Bruder wird in der distanzierteren 3. Person eines allwissenden Erählers vermittelt. Sweetness macht als junge Mutter den Anfang und beschließt den tristen Reigen des vielstimmigen Romans als Heimbewohnerin.
Die Diskriminierung der Schwarzen hat absurde Blüten getrieben. So liegen beispielsweise bei Trauungen in den Standesämtern zwei Bibeln aus, eine, die »für Neger reserviert war. Die andere war für die Hände der Weißen«. Es verwundert nicht, dass die »Gelben« (Halb- und Viertelmischlinge) über ihre helle Haut glücklich sind, denn damit konnten sie sogar als Weiße durchgehen. Sweetness ist eine solche sehr helle Farbige und stolz darauf. Umso größer sind ihr Schrecken und ihre Enttäuschung, als sie ihr Neugeborenes betrachtet. Ausgerechnet in der heikelsten Eigenschaft, wenn man in einer Gesellschaft der Segregation lebt, unterscheidet sich Tochter Lula Ann in furchterregendem Ausmaß von ihren Eltern: Mit einer Haut so schwarz wie Teer, dazu einer Augenfarbe, die »etwas Hexenhaftes« hat (»rabenschwarz mit einem Stich ins Blaue«), löst der Säugling bei seiner schockierten Mutter einen Moment lang höllische Impulse aus. Sie wirft eine Decke über den Kopf der unschuldigen Kleinen, bringt das Äußerste dann aber doch nicht fertig. Der Kindsvater erkennt das Baby nicht als seines an und setzt sich ab.
Permanente Gefühlskälte prägt Lula Anns Kindheit. Das »kleine Negerlein« an ihrer hellen Brust zu stillen ist der jungen Mutter widerwärtig. Niemals will sie »Mama« genannt werden, sondern bei ihrem Namen; das versteckt ihre Blutsverwandtschaft. Wenn die Leute der hübschen jungen Frau mit dem Kinderwagen begegnen und sich, darin etwas ebenso Süßes erwartend, darüber beugen, wenn dann auf einmal ihr Gesicht erstarrt und die Kosewörter fürs Baby ihnen im Halse stecken bleiben, dann soll wenigstens Sweetness (»Ich kann nichts dafür«) rein bleiben.
Sweetness' Erziehung besteht aus lauter strafenden Grausamkeiten. Sie glaubt zum Besten des Kindes zu handeln, um es auf sein zukünftiges Leben als diskriminierte Farbige vorzubereiten. »Ihre Farbe ist ein Kreuz, das sie immer zu tragen haben wird«, also ist es am besten, aus Selbstschutz wegzutauchen, gar nicht erst aufzufallen. Das Mädchen wehrt sich nicht, nimmt die brutalen Schläge, wie sie fallen. Es sehnt sich nach liebevollem Körperkontakt und nimmt die kräftigen Ohrfeigen als solchen hin.
Als junge Erwachsene aber entscheidet sich Lula Ann für den gegenteiligen Weg, die selbstbewusste Offensive. Sie nennt sich Bride, kontrastiert ihre dunkle Hautfarbe mit strahlend weißer Kleidung, wird von der Kosmetikindustrie zu einem Schönheitsideal stilisiert und als Ikone vermarktet. Aus dem »Negerlein« wird der »Panther im Schnee«, aus dem »Kreuz« ein reicher Geldsegen. Brides Produktlinie »You, Girl« ist eine Erfolgsgeschichte.
Nicht so Brides Privatleben. Ihr Geliebter Booker verlässt sie. Sie recherchiert ihm nach und findet heraus, dass er schwer traumatisiert ist, denn sein Bruder wurde missbraucht, bestialisch gefoltert und ermordet. Die Gemeinsamkeit belastender Kindheitserlebnisse führt Booker und Bride wieder zusammen.
Neben dem allgegenwärtigen Rassismus ist Kindesmissbrauch die zweite Geißel in der trostlosen Welt dieses Buches. Bookers Bruder ist keineswegs das einzige Opfer – auf den relativ wenigen Seiten dieses episodisch dicht gepackten Romans lesen wir noch von etlichen weiteren, und eine Untat ist abscheulicher als die andere. Die Täter sind überwiegend weiß, die Opfer schwarz. Besonders trist, welch fragwürdige Rollen die Frauen spielen: Sie verschließen die Augen, agieren selbst roh, herzlos, aggressiv und gewalttätig, und im schlimmsten Fall schlagen Mütter Kapital aus dem Leid ihrer eigenen Kinder.
Wer trägt Schuld an solchen Zuständen? Die Erzählerinnen argumentieren und rechtfertigen ihr Tun ausgiebig, aber die Multiperspektivität relativiert ihre Ansichten. Von der Justiz zur Rechenschaft gezogen und verurteilt wird lediglich eine Lehrerin, nachdem Lula Ann sie vor Gericht schwer belastet hat – aber wie zuverlässig ist diese Zeugin? Und das Mädchen Rain, von der Mutter zu Sex-Dienstleistungen gezwungen, setzt sich mit ihren Zähnen zur Wehr. Das verdirbt der Mutter das Geschäft, die Rechnung aber muss das Kind selbst bezahlen, denn unverkäuflich wie es ist, wird es kurzerhand vor die Tür gesetzt.
Obwohl Toni Morrison einen prägnanten, schnörkellosen, der Alltagssprache nahen Sprachstil pflegt (Übersetzung: Thomas Piltz), ist die Lektüre nicht einfach. Die Autorin gönnt uns keine Zuversicht. Bis zur Unerträglichkeit reiht sie Episoden fragwürdigen bis widerwärtigen Verhaltens aneinander. Etliche dieser Handlungsfäden werden nicht zu Ende geführt und nie mehr aufgegriffen, erscheinen daher wie Staffage fürs Gruselthema. Die Menschen, die unter den geschilderten Bedingungen jenseits ihres Einflusses aufgewachsen sind und leben müssen, müssen verzweifeln, richten ihren abgründigen Hass auch gegen sich selbst, Aggression und Gewalt sind Ventile für den Druck, unter dem sie permanent stehen.
Das Übermaß des Schreckens und die Eindimensionalität des Gesellschaftsbildes führen beim Leser leicht zu Überdruss, womit die Autorin die Kraft ihrer Anklage schmälert. Einzig die Geschichte von dem schönen, erfolgreichen Mädchen Bride, die auszog, um ihren Lover wiederzufinden, ist ein wenig sentimental und voller Abenteuer. Ein modernes Märchen mit einer modernen Prinzessin. Doch zu viele Bitterstoffe vergällen den Geschmack dieses Beinahe-Happy-Ends.
Der amerikanische Originaltitel – »God help the child«  (»Gott helfe ...« oder »Möge Gott ... helfen« oder gar »Nur Gott kann ... helfen«) – drückt eine fatalistischere und pessimistischere Haltung aus als der deutsche Imperativ an den Allmächtigen, der retten soll, wo also noch etwas zu retten ist. Daran aber mag man am Ende dieses Buches kaum noch glauben.
(»Gott helfe ...« oder »Möge Gott ... helfen« oder gar »Nur Gott kann ... helfen«) – drückt eine fatalistischere und pessimistischere Haltung aus als der deutsche Imperativ an den Allmächtigen, der retten soll, wo also noch etwas zu retten ist. Daran aber mag man am Ende dieses Buches kaum noch glauben.
 · Herkunft:
· Herkunft: