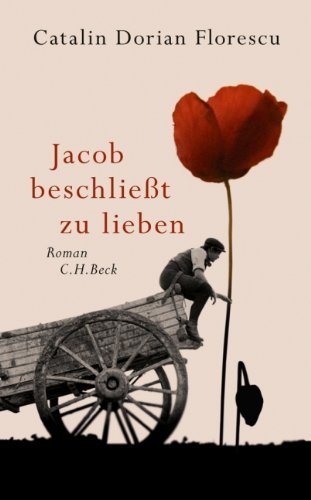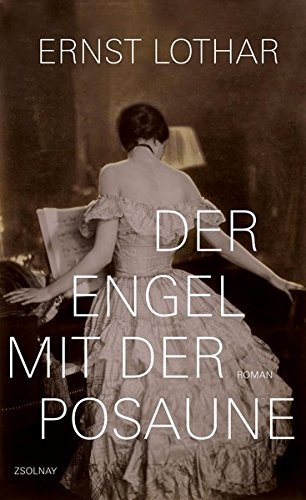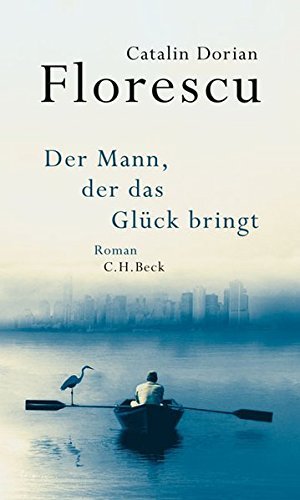
Zwei Schicksalskreise
Der Zufall führt eine Frau und einen Mann in einem New Yorker Kellerlokal zusammen. Sie kommen ins Gespräch, verabreden sich erneut, erzählen einander von ihren Familien, trennen sich wieder. Sie sind nicht verwandt, ihre Wurzeln liegen auf zwei Kontinenten in zwei grundverschiedenen Kulturen. Schicksalhaft erscheint ihre Begegnung dennoch. Beide sind mehr oder weniger bewusst bestrebt, Wünsche ihrer Vorfahren zu erfüllen.
Catalin Dorian Florescu, in Zürich lebender Schriftsteller rumänischen Ursprungs (1967 in Timișoara geboren), hat sie zusammengeführt. Der unerschöpfliche Fabulierer und starke Gestalter webt aus den beiden Erzählungen einen unglaublich reichhaltigen, farbkräftigen Bildteppich, der das Kaleidoskop eines ganzen Jahrhunderts und zweier Regionen, die konträrer nicht sein könnten, umfasst. Unendlich viele historische Ereignisse unterfüttern die privaten Familiengeschichten und geben ihnen Weite.
Obwohl Florescu die beiden Erzählungen hübsch alternierend arrangiert, ist die Struktur des Gesamtstrangs kompliziert, da nicht nur die Schauplätze und Zeiten wechseln, sondern auch diverse weitere Erzählsituationen referiert werden. Obendrein überhöht er die Schicksalhaftigkeit des Geschehens durch allerlei Symbolik und Zahlenspiele: Die beiden Erzähler begegnen einander exakt am 11. September 2001, als die WTC-Türme einstürzen; eine große Liebe endet gewaltsam mit einer Feuersbrunst im Jahr 1911. Die beiden Ströme, die die Schauplätze durchfließen – der East River und die Donau –, werden als passive Leviathane charakterisiert, die »Abfälle, Ausscheidungen ... Verzweifelte, Müde, Verrückte« und »die Toten« aufnehmen.
Dabei stehen im Mittelpunkt aller Aufmerksamkeit durchweg die kleinen Leute. Sie kämpfen diesseits wie jenseits des Atlantiks ums nackte Überleben und bleiben doch chancenlos, in der aufblühenden, bereits hektischen Metropole New York ebenso wie in den archaischen Dorfgemeinschaften Rumäniens an den stillen Ufern des mächtigen Donaustroms, in der Hauptstadt eines ungebremsten Kapitalismus ebenso wie in Ceauscescus besonders deprimierender Ausprägung eines stalinistischen Unterdrückungsstaates, dem Armenhaus Europas. Während sich die Welt für die Gewinner energisch und profitabel weiter dreht, fallen die einfachen Menschen unaufhaltsam zurück, geraten unter die Räder. Florescu bewahrt ihre Kraft, ihren Mut und ihren Optimismus vor dem Vergessenwerden.
Der erste Erzählstrang setzt 1899 ein, als sich ein halbwüchsiger Waisenjunge mehr schlecht als recht am East River zwischen Bowery und Broadway durchschlägt. New York ist die Stadt der Verheißung und überschwemmt mit europäischen Auswanderern und Flüchtlingen – Iren, Italiener, Deutsche, Juden aus dem Osten, alle erhoffen sich hier bescheidenen Wohlstand, Sicherheit und Freiheit für ihre Traditionen, Religionen und Riten. Wer seine wirtschaftlichen Träume schon erfüllen konnte, zieht in die nördlichen Stadtviertel und demonstriert stolz seinen Erfolg. Über den Broadway wandeln Frauen in Samt und Seide und Männer im Pelz mit Zobelkragen. Die meisten Immigranten aber bleiben so arm, wie sie immer gewesen waren.
Der vierzehnjährige Junge weiß nicht, wo er herkommt (»vielleicht stammte er vom Mond«), und hat keinen Namen. Als sein einziger Freund, ein galizischer Judenbengel, im Schlaf erfriert, übernimmt er nicht nur dessen Mantel, sondern auch dessen Identität. Berl, wie er sich später nennt, kennt sein Territorium, das Ghetto, wie seine Westentasche. Mit ein paar anderen Straßenjungen schläft er in einem kalten, dreckigen Kellerloch und muss jeden Cent, den er als Zeitungsjunge und mit Gelegenheitsjobs verdient, an einen nur wenige Jahre älteren Bully und König im Geldmachen abgeben. Für seinen ewig knurrenden Magen bleibt nichts übrig.
Kurz bevor ihn der Hungertod ereilt, wendet sich Berls Schicksal. Der alte Jude Herschel findet ihn und päppelt ihn in seiner Wohnung auf. Herschel verdient gutes Geld, indem er im Keller seines Mietshauses Gänse züchtet. Wenn Berl sich nützlich macht und brav die jüdischen Gebete und Riten erlernt, kann er »das Geschäft einmal übernehmen«. Anerkennung findet Berl jedoch auch für seine wunderbare Stimme. Die schwangeren Frauen, die in der Wohnung gegenüber ein- und ausgehen, schwärmen für den jungen »Mann, der das Glück bringt«, sie mit seinen Liedern Zeit und Elend vergessen lässt. Sobald sie in aller Heimlichkeit entbunden haben, nimmt man ihnen das Neugeborene weg, ohne sie wissen zu lassen, was mit ihm geschieht. So weinen die Frauen ständig, vor Schmerzen, vor Trauer oder vor Glück. Berl, ihr kleiner »Caruso«, sieht sich derweil schon in den großen Varietés auftreten, um berühmt und reich zu werden. Hundert Jahre später träumt sein Enkel Ray noch denselben Traum, wenn er das überschaubare Publikum einer Kellerbar mit seiner Ein-Mann-Gesangsshow unterhält.
Der zweite Erzählstrang führt uns ins rumänische Mündungsdelta der Donau, »das Eingeweide Europas«. Es ist der Sommer 1919, doch die sumpfige, fisch- und vogelreiche Landschaft ist seit Menschengedenken unverändert, einsam, von Gott vergessen. Im »aus der Zeit gefallenen« Dorf Uzlina lebt Leni mit ihrem Mann Iulian und dem gutmütigen, mit einfachem Geist gesegneten Jugendlichen Vanea, dem Angehörigen einer russischen Minderheit, den sie in ihrer Familie aufgenommen haben.
Leni ist zum vierten Mal schwanger. Wie jeder Frau in Hoffnung fällt es ihr leicht, elementare Fehler zu vermeiden, die ihr Ungeborenes gefährden könnten. Nie würde sie in den Ofen pusten oder sich einen Wollfaden um den Nacken legen. Aber nach drei Fehlgeburten will Leni dieses Mal alles richtig machen und hat sich nach allen Regeln überlieferter Künste gegen böse Geister und Teufel in jeglicher Gestalt gewappnet. Als die Zeit der Niederkunft naht, befreien rituelle Waschungen und Beschwörungsformeln sie von Sünden, dann heißt es sich schonen und gut ernähren, nicht Lehm, Verputz, Kreide und Salzklumpen essen und Ziegelsteine lecken wie vormals.
Unter solch archaischen Umständen wird 1920 das sehnsüchtig erwartete Glückskind geboren. Ein Sohn, der beim Fischfang helfen könnte, ist es nicht, aber eine gesunde Tochter ist gut genug, um Strümpfe zu stopfen, zu kochen und den Haushalt sauber zu halten. Sie erhält den Namen Elena wie ihre Mutter und wird ihn später an ihre Tochter, die Erzählerin, weitergeben.
Die kleine Elena ist ein anstelliges, wissbegieriges Kind. Bald zieht es sie weg aus der häuslichen Enge. Im Nachbardorf kommt sie bei einem alten Friseur unter, und es eröffnet sich ihr sogar eine winzige Chance, nach New York zu heiraten. Doch eine furchtbare Krankheit macht alle Träume zunichte. Die Hoffnungsträgerin, der kein Glück beschieden war, verbringt den gesamten Rest ihres Lebens in der Isolation einer Leprastation.
Der Erzählerin war ihre Mutter so verhasst, dass sie sie in der Aussätzigenkolonie niemals aufsuchte. Als sie 1961 geboren wurde, nahm man der schwerkranken Frau das Kind sogleich ab und gab es in die Hände von Pflegeeltern. So wuchs Elena – die dritte – bei regimetreuen Kommunisten, Arbeitern und in desolaten Heimen auf. Jetzt ist ihre Mutter verstorben, und Elena soll den letzten Wunsch der Frau, die sie niemals kennengelernt hat, erfüllen: Sie soll ihre Asche nach New York bringen und über der Stadt ihrer verlorenen Sehnsüchte verstreuen. Es ist der 11. September 2001, und die Schicksalskreise schließen sich.
Die beiden episodenreichen Erzählstränge sprechen den Leser emotional sehr unterschiedlich an. Großvaters Überlebenskampf in der pulsierenden Millionenstadt, deren farbenfrohes Alltagsgetriebe detailreich geschildert wird, ist von einer eisernen Zuversicht des Individuums beseelt, die weder Armut noch Härte noch Niederschläge erschüttern zu können scheinen. Demgegenüber lässt das Elend im rumänischen Donaudelta, wie es uns über drei Generationen hinweg erzählt wird, schier verzweifeln. Hier wird jede Hoffnung schon von Anfang an erstickt – durch Engstirnigkeit und Aberglauben der schuldlos rückständigen Bewohner, durch unsägliche Armut, durch ein brutales Unterdrückungssystem, durch entsetzliche Krankheiten, denen die geschundenen Menschen hilflos ausgeliefert bleiben.
 · Herkunft:
· Herkunft: