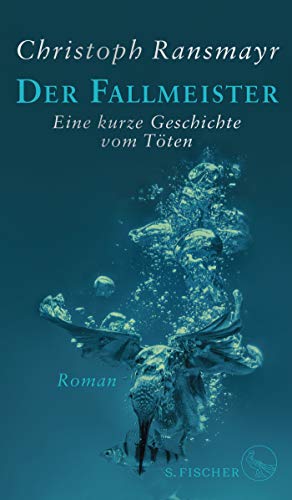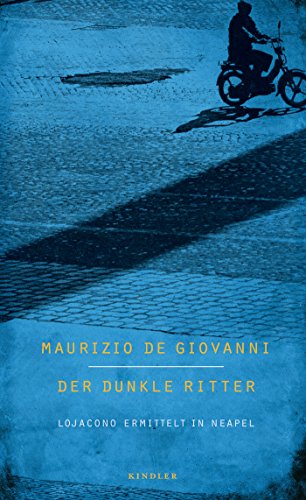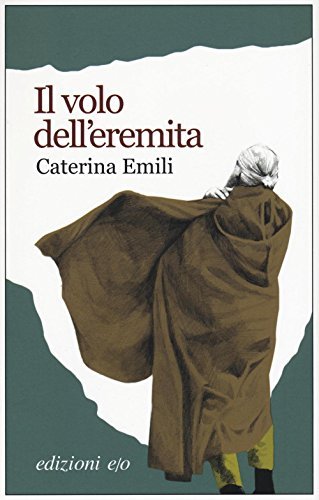Herrscher über die Zeit
James Cox war nie in China. Die Manufakturen des umtriebigen Londoner Uhrmachers (1723-1800) produzierten mechanische Meisterwerke wie bewegte Vögel und repräsentativ verzierte Zeitmesser, die beim europäischen Adel gut ankamen. Ganze Schiffsladungen seiner Kreationen reisten aber auch an den kaiserlichen Hof in Běijīng und sind dort noch heute ausgestellt. Der wagemutige Unternehmer mit wechselhaftem Schicksal inspirierte den österreichischen Schriftsteller Christoph Ransmayr zu einem packenden Roman, der Abenteuer, Exotik und ein drastisches Bild der chinesischen Gesellschaft der Zeit mit einer philosophisch überhöhten, anregenden Interpretation dessen verbindet, was geniale Erfinder wie Cox zu erschaffen vermochten und die Allmachtsfantasien ihrer Auftraggeber anstachelte.
Cox, bei Ransmayr mit dem Vornamen Alister fiktionalisiert, gebietet wie sein Vorbild James über ein Heer von 900 Feinmechanikern, Juwelieren, Gold- und Silberschmieden in seinem boomenden Unternehmen Cox & Co mit Hauptsitz in London und etlichen Werkstätten. Schon während der Meisterausbildung in Manchester hatte Cox mit der Erschaffung einer »Himmelsuhr« sein einzigartiges Talent bewiesen. Dieses Wunderwerk, eher ein Heiligtum als ein Messinstrument, lässt die britische Ostindienkompanie dem chinesischen Kaiser Qiánlóng als Geschenk zukommen, auf dass er den englischen Handelsgesellschaften in ihrem Bestreben, sich neue Märkte im Fernen Osten zu erschließen, wohlgesonnen sei.
Das Präsent fällt auf fruchtbaren Boden. Wie seine europäischen Kollegen ist Qiánlóng ein leidenschaftlicher Sammler. Mit einem gewichtigen Unterschied: Er ist Gottkaiser, »Herr über Himmel und Erde«, dessen Macht und Mittel keine Grenzen kennen; sein Wille ist ehernes Gesetz. Daher erfreuen sich seine Augen an der umfangreichsten Kollektion pompös verzierter Chronometer und ausgefallener Automaten, die mit Nachtigallenstimme die Stunden verkünden oder auf silbernem Wasser zu gleiten scheinen. Der Wunsch des Kaisers, den Schöpfer solcher Wunderwerke an seinen Hof einzuladen, ihm Zugang in die »Verbotene Stadt« zu gewähren, ist Befehl, ruft aber auch Verwunderung hervor. Doch derlei Fragen dürfen nicht einmal gedacht werden; ausgesprochen, würden Tausende offene Ohren den Frevel vernehmen und im gedrungenen Flüsterton weitergeben. Wird ein solcher Schwätzer entdeckt oder denunziert, erwartet ihn eine unerschöpfliche Auswahl an Folterqualen, von denen ihn erst ein möglichst lange hinausgezögerter Tod erlöst. Zuerst wird seine Zunge herausgeschnitten, dann vielleicht flüssiges Eisen in seinen Hals gegossen.
Als kaiserliche Gesandte aus China die Einladung in London überbringen, ist Alister Cox gerade am Boden zerstört. Eine Krankheit hat ihm das Liebste, seine fünfjährige Tochter Abigail genommen, seine geliebte, wesentlich jüngere Ehefrau Faye war verstummt, hat sich in ihre eigene Welt zurückgezogen. Cox erwartet und wünscht nichts mehr im Leben, als er in dieser trostlosen Lage die Worte des Dolmetschers nur von Ferne vernimmt. Hofft »der traurigste Mann der Welt«, indem er die Herausforderung annimmt, auf eine Entscheidung des Schicksals, das ihn in den schwarzen Tiefen des Ozeans seinen Frieden finden lasse?
Eine Ewigkeit von sieben Monaten ist Cox mit seinen drei fähigsten Mitarbeitern unterwegs. Das Segelschiff gleicht einer Arche Noah mechanischer Kreaturen aus Silber und Gold, verziert mit Edelsteinen: Spielzeuge für den Himmelssohn.
Was für eine radikal andere Welt als im aufgeklärten Westen die begnadeten Feinmechaniker erwartet, verdeutlicht ihnen gleich ihre Ankunft in der Bucht von Háng zhōu auf drastische Weise. Kein roter Teppich rollt ihnen entgegen, sondern das rote Blut abgeschlagener Steuerbetrüger-Nasen vom Richtplatz. Den Neuankömmlingen wird der Dolmetscher Joseph Kiang zur Seite gestellt, auf dass er ihnen dieses Universum, vollständig abhängig von der Willkür des maßlosen Alleinherrschers, erkläre und folgenschwere Fehltritte erspare. Selbst die Sinneswahrnehmung der Untertanen reglementiert der Allerhöchste. Ihnen soll möglichst alles auf ewig verborgen bleiben, so wie der Kaiser selbst seinem Hofstaat ein »Unsichtbarer« ist. Schon ein Augenaufschlag auf etwas »Unerwartetes« gilt als Sakrileg und muss grausam geahndet werden, indem etwa eine »Gafferschere« mitten in beide Augäpfel gestoßen wird.
Cox fröstelt nach diesen ersten Impressionen, und mehr noch, als Joseph Kiang ihm des Kaisers Auftrag erläutert. Er wolle »kein Spielzeug«, sondern »Ihren Kopf«. Er möchte sich Kreativität, Fantasie, Leistungsfähigkeit und Kunstfertigkeit der Engländer zu Diensten machen, um sich auch zum absoluten Herrscher über die Zeit aufzuschwingen. Die Langnasen sollen für ihn »Mühlen für den Lauf der Zeit« erschaffen, Maschinen, die nicht nur das Vergehen der Zeit messen, sondern das Empfinden von Zeit erfassen, etwa die Lebenszeit eines Kindes, eines Liebenden, eines Sterbenden spürbar machen.
Bei der Planung der Zeituhr eines Kindes kehren Cox' schmerzvolle Erinnerungen anAbigail zurück. Doch die Vorstellung dieses »jenseits aller Räume und Zeiten ruhenden Kindes« erhebt Cox beim Bau der Uhr über seinen alles wollenden Auftraggeber. Da die Zeit eines Kindes wellenförmig an- und abschwellend vergeht, erstellt Cox ein »Silberschiff«, eine Winduhr mit einem Segel als Energiequelle, eine verspielte Dschunke für seine Tochter.
An die Grenzen seiner Bereitschaft, sich dem kaiserlichen Willen zu unterwerfen, führt Cox dessen nächster Auftrag, eine Uhr zu erfinden, die die Zeitempfindung eines Todgeweihten erfasst, eines Menschen, der seinen Todeszeitpunkt kennt, in Todesangst um Gnade bettelt. Dazu müsste Cox die Verurteilten in ihren stinkenden, düsteren Verliesen aufsuchen, sie befragen und Anschauungsmaterial sammeln. Cox protestiert, doch Kiang, der auch immer um sein eigenes Leben fürchten muss, lässt keinen Zweifel daran, dass allein der Wille des »Erhabenen« gilt.
Den ultimativen Anspruch, sich über den Lauf der Zeit zu erheben, stellt der Kaiser mit dem Auftrag, eine Uhr für die Ewigkeit, ein Perpetuum mobile zu konstruieren. Darin erkennt Cox erstmals eine gewisse Seelenverwandtschaft. Und wo sonst als an diesem Ort unermesslicher Ressourcen und unbegrenzter Möglichkeiten könnte ein solches Werk, nach dem alle Uhrmacher, Mechaniker und Physiker der Welt seit Langem streben, Wirklichkeit werden? Anderswo unvorstellbare »einhundertneunzig Pfund Quecksilber«, kalkuliert Cox, könnten Luftdruckschwankungen messen und zum ewigen Antrieb einer atmosphärischen Uhr nutzen.
Doch der Meister muss auch erkennen, welchen Preis die Hybris fordert. Den Schöpfer eines Werkes, das dauerhafter als die Zeit selbst ist, kann der Kaiser als »Herr über die Zeit« niemals tolerieren. Joseph Kiang warnt die Engländer mit ungewohnt leidenschaftlichem Nachdruck, dass mit dem letzten Handgriff, der die zeitlose Uhr vollendet, ihre letzte Stunde angebrochen wäre. Cox, wiewohl an seine eigene Endlichkeit erinnert, hat keine andere Wahl, als den kaiserlichen Auftrag zu erfüllen, kann aber immerhin Einfluss nehmen, die Zeit beschleunigen oder verlangsamen und nach einem Ausweg aus der prekären, tödlichen Sackgasse suchen.
Christoph Ransmayr ist ein faszinierender, stofflich ausgefallener, meisterlich erzählter und feingeistiger Roman gelungen, der selbst mit der Präzision eines Uhrwerks tickt – ohne Dialoge, manchmal als sachlicher Reisebericht, bisweilen auch voller Poesie und Spiritualität. Der mit grausamer Allmacht herrschende Kaiser, im »Palast der himmlischen Harmonie« allen Blicken enthoben, ist gleichwohl selbst ein Gefangener der Rollen und Rituale. Trotz 41 Ehefrauen, 3000 Konkubinen und einer Schar willfähriger Eunuchen, Schranzen und Berater zu seinen Diensten ist er klein und allein. Hinter seiner unnahbaren Maske verbirgt sich der Mensch Qiánlóng, ein Mann von 42 Jahren, der Gedichte verfasst, mit großem Pinsel vergängliche Schriftzeichen auf heißen Stein kalligraphiert, Cox' mechanische Wunderwerke wie ein spielendes Kind bestaunt. Und auch das Genie Cox ist keine Maschine, sondern ein beseelter Mensch. Allerdings ist es ausgerechnet die Kindfrau An, die ihn zu neuem Leben erweckt – des Kaisers liebste Konkubine.
 Bücher und Musik für Advent und Weihnacht
Bücher und Musik für Advent und Weihnacht
 · Herkunft:
· Herkunft: