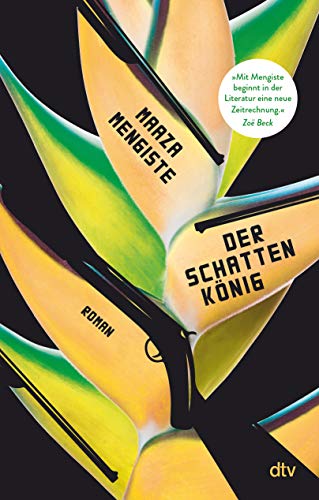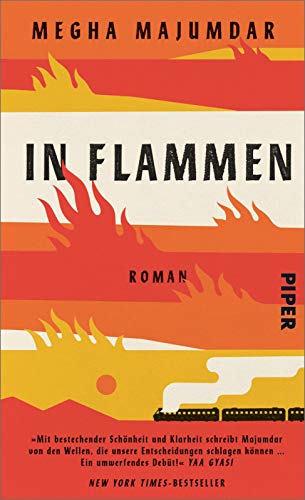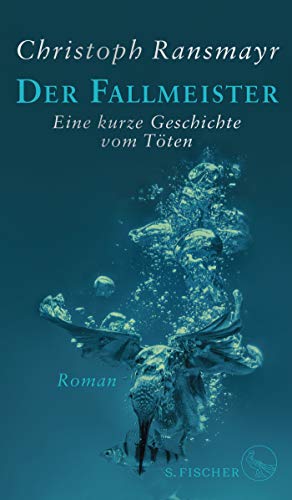
Der Fallmeister – Eine kurze Geschichte vom Töten
von Christoph Ransmayr
Fünf Menschen ertrinken, als ihr Boot in einer tosenden Wasserrinne außer Kontrolle gerät. Hat der Schleusenwärter versagt oder gar gemordet? Genau ein Jahr danach stürzt er sich selbst in die Fluten. Sein Sohn, ein weltweit tätiger Hydrotechniker, nimmt die Suche nach der Wahrheit auf.
Rückkehr zu den Quellen
Motive, einen Mord zu begehen, haben Schriftsteller schon viele bearbeitet – Habgier, Eifersucht, Rache, Machtbesessenheit, wir kennen alle Varianten. Ebenso die Methoden zu töten – erwürgen, erstechen, erschießen, vergiften … Für den Titelhelden seines neuesten Romans hat Christoph Ransmayer eine originelle Art Fernsteuerung ersonnen, mittels derer er gleich mehrere Mitmenschen umbringt. Er berührt »dabei kein einziges seiner Opfer oder sah ihm auch nur in die Augen, sondern flutete über eine Reihe blanker Stahlwinden eine der Flußschiffahrt dienende Bootsgasse.« Auf diese distanzierte Weise, konstatiert gleich der erste Satz mit einem Paukenschlag, hat »mein Vater […] fünf Menschen getötet«.
»Mein Vater« – das ist ein namenloser Schleusenwärter in einer fiktiven Alpenlandschaft, die unschwer als die Heimat des Autors, das Salzkammergut zu erkennen ist. Hier verfrachteten die Menschen über Jahrhunderte das in Hallstatt gewonnene kostbare Salz auf der Traun nach Norden, bis diese bei Linz in die Donau mündet. Um den Wasserfall bei Roitham umschiffen zu können, legte man dort eine raffinierte Serie hölzerner Rinnen (sogenannte Bootsgassen) mit beherrschbarem Gefälle und Schleusen an, die von hochgeachteten Spezialisten mit dem Berufs- und Ehrentitel »Fallmeister« betrieben, überwacht und instandgehalten wurden. Lebensgefährlich blieb die Passage auf den hinunterschießenden Wassern allemal, wie die Chroniken berichten.
So zweifelt niemand daran, dass das im Roman erzählte Ereignis am »Großen Fall« (so die Bezeichnung im Roman) ein tragischer Unfall ist – ausgerechnet am Festtag des heiligen Nepomuk, der doch Schutzheiliger all derer ist, die mit jeglicher Gefahr des Wassers zu tun haben. Zwölf Ausflügler lassen sich des Spaßes halber in einem der flachbodigen Langboote vom schnell strömenden Wasser die Schussrinne hinabtreiben, als das Gefährt außer Kontrolle gerät und in den Strudeln des Beckens, wo sich der Umgehungskanal wieder mit dem »Weißen Fluß« vereint, zerschellt.
Niemand äußert den Verdacht, der Fallmeister habe seine Pflicht vernachlässigt – im Gegenteil: Ist nicht auch dieser gewissenhafte Mann ein Opfer der Katastrophe? Dass er genau am Nepomukstag des nachfolgenden Jahres selbst auf den Wasserfall zutreibt, regungslos im Angesicht des Todes, bezeugt doch seine Seelenpein. Dessen ungeachtet ist sein Sohn von Anfang an überzeugt, dass der Vater die todbringende Flutwelle in der Bootsgasse mit Absicht ausgelöst hat, und noch nach Jahren der Nachforschungen und weltweiter Erfahrungen hält er an seiner Behauptung fest.
Wer war dieser Vater, dass man ihn als Ehrenmann achten und als kaltherzigen Mörder einschätzen konnte? Und wenn er gemordet hat: Was war sein Motiv? Wir sehen ihn nur durch die Augen des Ich-Erzählers, des ebenfalls namenlosen Sohnes, und der beschreibt ihn als disparaten, ambivalenten Charakter: mal liebevoll, mal despotisch strafend, mal begeisterungsfähig, mal in sich gekehrt und schweigsam, oft jähzornig. Seine fachliche Kompetenz verschafft ihm Anerkennung und Respekt, und so ernennt man ihn zum »Fallmeister« in seinem Heimatdistrikt, der »Grafschaft Bandon«. Doch das Bauwerk am Wasserfall, seit Jahrhunderten nicht mehr benötigt, ist nur noch eine weitläufige Museumsanlage und der ehrwürdige »Fallmeister« ihr Kurator, der die imposante Anlage zu gegebenen Anlässen voller Stolz vorführt. Die Aufgabe entspricht voll und ganz dem Naturell des Vaters, der sich immer entschiedener der Vergangenheit zuwendet, »in der alles vertraut erschien«, und dabei mit der Zeit derart verhärtet, dass er »mit einem unstillbaren Hass auf die Gegenwart« schaut.
Vermittelt wird uns diese eigentümliche Stimmung, die nichts mit Nostalgie zu tun hat, durch Ransmayrs berückenden, bildstarken Sprachstil, die elementare Wucht der erzählten Ereignisse, die unveränderlich scheinende, archaisch anmutende Naturlandschaft, die der kleine Mensch trotz seiner Geschicklichkeit nicht zähmen kann. All dies versetzt uns beim Lesen selbst in einen Zustand schwebender Zeitlosigkeit. Aus der Stimmigkeit des allgemeinen Bildes, das aus einem früheren Jahrhundert stammen könnte, fallen die Ausführungen des Sohnes zu seinen globalen Wasserbauprojekten wie Fremdkörper, öffnen uns aber die Augen, dass die Distanz nur eine Generation ausmachen kann.
Wasser ist das tragende Element des Romans, schwer zu fassen und schwer zu bändigen. Es bestimmt auch das Leben des Sohnes, der als hochqualifizierter Hydrotechniker durch die Konzeption und Errichtung neuartiger Kraftwerkssysteme an den großen Flüssen der Welt die Geschicke ganzer Subkontinente beeinflusst. Indem wir seinen Aktivitäten über die Jahre folgen, lassen wir die Epoche der alten Fallmeister weit hinter uns, überholen auch unsere Jetztzeit und finden uns in einer ungefähr zweihundert Jahre entfernten Zukunft. Die Polkappen sind geschmolzen, die Meeresspiegel gestiegen. »Seit dem Ende der Epoche fossiler Energien« ist Wasser zum wertvollsten Gut der Welt geworden, um das immer wieder »Wasserkriege« und ethnische Konflikte ausbrechen. Die politischen Gewichte haben sich von West nach Ost verlagert, und Europa ist in bedeutungslose, selbstgefällige Kleinstaaten zerfallen, die ihr Heil in der Rückkehr zu uralten Mythen und Begriffen suchen (daher »Herzogtum«, »Grafschaft«, Eindeutschungen, Tilgung der Rechtschreibreform). Alle Ressourcen, Macht und Rechte haben sich derweil globale Konzerne, Netzwerke von Syndikaten und immer reicher werdende Eliten angeeignet, die kein Gesetzgeber mehr eingrenzen kann, und kostbare Freiheiten wie das Passieren von Grenzen stehen nur der »Kaste neuer Aristokraten« zu. Zu ihr gehören die Hydrotechniker.
Man kann nachvollziehen, dass der Vater all diese Entwicklungen verachtet, ja hasst. Die zivilisatorischen Rückschritte tangieren seine Existenz ganz unmittelbar, wenn etwa seine Ehefrau in Folge ethnischer »Säuberungen« in ihre adriatische Heimat deportiert wird. Verständlich, dass er »seiner Gegenwart entkommen und zurück in den Glanz der Vergangenheit [will], um wieder zu dem zu werden, was die Fallmeister vergangener Jahrhunderte mit ihrer Kunst gewesen waren, den Weißen Fluß zu beherrschen: Herren über Leben und Tod«. Dafür, so räsonniert sein Sohn, scheint ihm ein »Menschenopfer … am Nepomukstag« wohl angemessen.
Ransmayr spielt mit Elementen diverser Genres. Sein Buch ist eine Familien-, eine Liebesgeschichte, eine Dystopie, ein Krimi und nicht zuletzt ein bunter Abenteuerroman aus exotischen Weltgegenden. Die Schilderungen etwa vom dreitägigen »Wasserfest«, das man im Königreich Kambodscha derart rauschhaft feiert, dass es sogar »die Erinnerung an die Schreckensherrschaft der Weißen Khmer besänftigt«, sind mitreißend. Die Menschen bejubeln das Ende des Monsuns und das spektakuläre Naturphänomen der »Strömungsumkehr« an einem Nebenfluss des Mekong. Abhängig von den Regenzeiten ändert er seine Fließrichtung. Wie der Fluss zu seinem Ursprung zurückstrebt, wird im Roman zur Metapher für »Zeitumkehrung«.
Im Angesicht einer verabscheuten Gegenwart wendet sich der Blick zurück auf die Glorie der Vergangenheit, selbst wenn sie durch Jahrhunderte verfinstert ist. So suchten die kambodschanischen Khmer die Zeit mit Gewalt umzudrehen, so ruderte der »Fallmeister« in der Zeit zurück, »bereit […], jedes Wesen der Gegenwart auszulöschen«, »gegen den Strom musste dann jener Weg führen«, und dabei zerreißt die dünne »Membran zwischen einem menschlichen Dasein und der Bestialität«.
Kann diese Theorie uns überzeugen? Das muss sie nicht. Wir wissen ja, dass sie der Erzähler vorbringt, und wir haben erfahren, dass der selbst sein Päckchen zu tragen hat. Bei ihm hallen immer wieder intensive Erinnerungen an die tief prägenden Erlebnisse mit seiner Schwester Mira nach, mit der ihn einmal eine (allzu) zärtliche Beziehung verband. Die ungeklärten Umstände um den Tod des Vaters lassen ihn an die Stätte der gemeinsamen Kindheit zurückkehren, wo ihn der Zauber der Erinnerung und die Sehnsucht nach verlorener Zärtlichkeit ergreifen und weitertreiben, zu ihr hin, zu ihr zurück. Mira war nach Friesland gezogen, in »die größtmögliche Entfernung zum Großen Fall, zum Leben unserer Eltern […] und vielleicht auch zu ihrem Bruder […] Sie wollte um keinen Preis dorthin zurück, niemals«. So weist sie ihn zurück, anstatt ihm eine Umarmung zu schenken.
Man kann in diesen bizarren, exzentrischen, wendungsreichen Roman wahrlich genussvoll abtauchen und einfach nur die ungewöhnliche Sprache genießen (wiewohl sie bisweilen reichlich gestelzt wirkt und manche Satzbauten ganze Seiten füllen). Er entführt uns in nie gedachte fantastische Welten, in Mythen längst vergangener Kulturen, in psychologische Abgründe und reichlich spinnerte, schwülstige Liebesduseleien. Erstaunlich, wie sich mit den deprimierenden dystopischen Visionen einer gar nicht so irrealen Zukunft dann doch eine nostalgische Stimmung einstellt.
 · Herkunft:
· Herkunft: