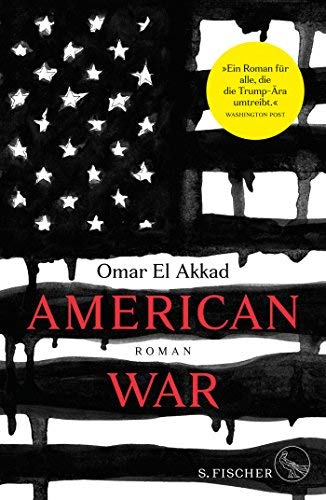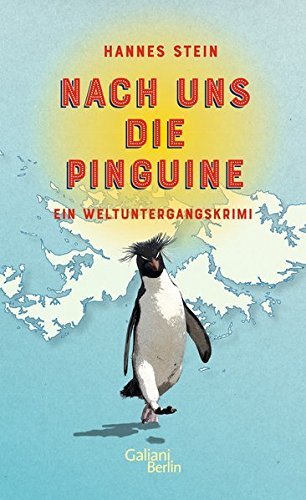
Was von uns Menschen übrig bleibt
Wir befinden uns in gar nicht ferner Zukunft. Die ganze Menschheit ist dahingerafft ... Die ganze Menschheit? Nein! Ein von unbeugsamen Briten bevölkertes südatlantisches Eiland hat dank seiner splendid isolation überlebt. Und so halten die dortigen Untertanen Ihrer verblichenen Majestät die Tugenden der ältesten (und einzig überlebenden) Demokratie hoch, diskutieren im Pub bei lauwarmem Bier über Gott und die Welt, entspannen bei scones und tea, essen Fish'n'Chips aus Zeitungspapier und Steak-and-Kidney Pie, als wäre nichts geschehen.
In letzter Zeit sind zu den dreieinhalbtausend Falkländern (davon ein Drittel Militärs) ein paar Fremde hinzugestoßen. Seit dem Exitus der Menschheit – »betrübliche Ereignisse, über die wir nicht gerne reden« – ankert vor der Hauptstadt Stanley die Serendipity (»glücklicher Zufall«), ein US-Kreuzfahrtschiff. Als es einst Fort Lauderdale, Florida, mit dem Ziel Antarktis verließ, herrschte noch Frieden auf Erden. Doch während seiner vergnüglichen Reise durch den Atlantik spitzten sich seit Langem gärende Krisen (beklemmend, wie vertraut sie uns alle aus den täglichen Nachrichten sind) blitzschnell zu, und ehe die Welt es sich versah, hatte jeder hitzköpfige Diktator, verbohrte Ideologe oder rechtgläubige Religionsführer alles, was sein Arsenal an heißen Spielsachen (Viren und Bakterien inklusive) hergab, über oder mitten in seinem jeweiligen verhassten Nachbarland freigesetzt. Eine Kettenreaktion, die eine Region nach der anderen für immer von der Landkarte getilgt und die Existenz der Menschheit rasch beendet hatte, als das Schiff die Insel der Glückseligen erreichte.
Deren Bewohner waren allerdings wenig begeistert von dem Andrang. Schließlich mussten sie alle wertvollen Ressourcen wie Treibstoff in aufwändigen Expeditionen vom argentinischen Festland beschaffen. So durften nur die wenigen, deren Qualifikation auf der Inselgruppe gefragt war, das Schiff verlassen und auf Einbürgerung hoffen.
Einer dieser assimilierten Neu-Insulaner ist Josh Feldenkrais, der Ich-Erzähler. Der gebürtige New Yorker betreibt nun schon seit geraumer Zeit den Radio- und Fernsehsender (der nichts als erbauliche Kost wie Coronation Street, East Enders und James-Bond-Filme ausstrahlt). Das gemächliche, selbstzufriedene Leben in der einsamen Enklave menschlichen Lebens, die mit ihrer Population von einer halben Million Schafen und dreizehn Pinguin-Arten das Zeug zu einer friedlichen Insel Utopia hätte, könnte getrost so weitergehen. Doch dann geschieht ein rätselhafter Mord, der Josh Feldenkrais' Instinkte als investigativer Reporter weckt und eine Krimihandlung in Gang setzt, die der Idylle den Garaus macht.
Gewiss hat Hannes Stein Spaß am Sammeln und Spielen. Mit Fleiß und Eifer muss er enzyklopädische Zettelkästen zu verschiedenen Kulturen, historischen Zusammenhängen und literarischen Genres vollgepackt haben, und aus diesen Bausteinen bedient er sich, um originelle Romane zu konzipieren. Aber der Autor bildet die Tatsachen nicht einfach ab, sondern verfremdet sie durch einen »Was wäre, wenn ...?«-Filter. In seinem Erstling »Der Komet« [› Rezension] ersparte er Erzherzog Franz Ferdinand den frühen Tod in Sarajewo, der Welt die Weltkriege und den europäischen Monarchien den Untergang. Die Handlung spielt in einem k.-u.-k.-seligen Wien, der Hauptstadt der ruhmreichen Habsburger-Großmacht, während unser Planet vom titelgebenden Himmelskörper bedroht ist. In Steins zweitem Buch hat sich die Menschheit bereits selbst eliminiert, aber ein Häuflein Überlebender zelebriert unbeeindruckt Britannia mit all ihren liebenswerten und kauzigen Eigenheiten.
Neben solch traditionsreichen Kulturen ist Stein – nach eigenem Bekunden schon seit Kindertagen – fasziniert von »closed room mysteries«, Mordtaten in hermetisch begrenzter, enger Umgebung und mit wenigen Beteiligten, von denen im Prinzip jeder durch einige der anderen als Täter ausgeschlossen wird. Wie konnte der Mörder unbemerkt in den abgeschlossenen Raum eindringen und/oder entweichen, wie töten, ohne eine Spur zu hinterlassen? Dieses Krimi-Element hat der Autor als roten Faden in den globalen Weltuntergangs- und den britischen Kulturrahmen eingewoben. Aber der Mordfall packt den Leser nicht richtig. Zu konstruiert sind die Umstände, zu unauffällig charakterisiert die Verdächtigen, zu verschwurbelt die Aufklärung (»Irgendwo zwischen oder hinter den zitierten Sätzen steckte die Antwort.«), zu eigenwillig die Lösung, zu gesucht die deus-ex-machina-Schlusswendung.
Bei distanzierter Betrachtung des Ganzen stellt sich die Frage, ob das Setup aus Genre- und Motivbausteinen einem ›höheren Zweck‹ dient oder bloß den aktuellen Vorlieben des Autors entsprungen ist und ebenso gut ganz anders hätte gemixt werden können. Was ist nur Spiel, was hintergründiger Ernst, was Ironie, was Philosophie, was reine Virtuosität? Wie schon in »Der Komet« konnte ich nichts erkennen, was auf ein ›Anliegen‹, eine ›tiefere Bedeutung‹ schließen lässt, habe das freilich auch nicht vermisst. Denn das Lesevergnügen entsteht erneut aus der gepflegten, eleganten Sprache (selbst Zoten kommen als Limericks geadelt daher), der Vielzahl intelligenter Anspielungen, Bezüge, Verweise, Zitate (Bibel, Shakespeare, Robert Burns, ...), dem differenzierten Geschichtswissen (oft sokratisch-dialogisch aufbereitet) und dem Reichtum an bildkräftigen Szenen, anregenden, amüsanten Dialogen und witzigen Einfällen der Handlungsführung.
Leider liest sich »Nach uns die Pinguine« nicht so kurzweilig wie »Der Komet«. Gerade da, wo es dem Autor ernst zu sein scheint, weicht die Leichtigkeit des Tons und der Gedanken. So ist die Persönlichkeit des Erzähler-Protagonisten ohne jede interne Notwendigkeit überfrachtet: Josh Feldenkrais ist homosexuell, Jude und Mormone, was allerlei Exkurse veranlasst, deren Toleranz heischende Untertöne nicht so recht ins Konzept passen.
Eine Leseempfehlung mit einigen Einschränkungen.
 · Herkunft:
· Herkunft: