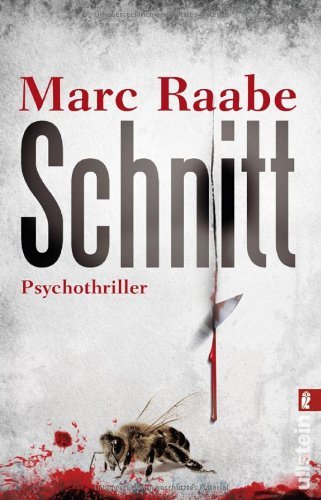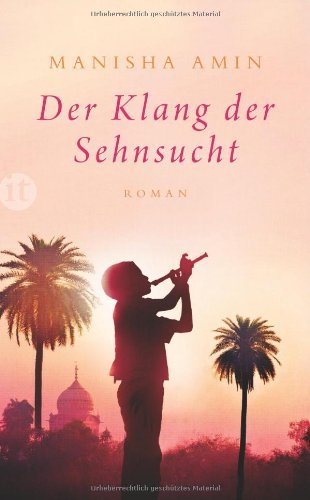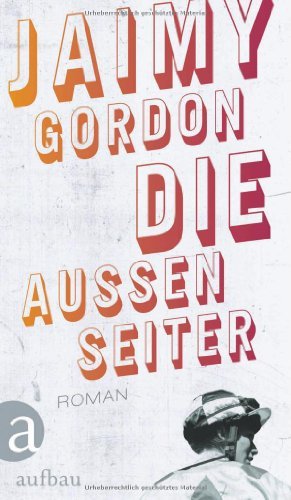
Von Pferden und Menschen
Eleganz, high society, Champagner und Sonnenschein – daran denken wir, wenn es um Pferderennen geht. Europas Glanz strahlt in Ascot, Epsom Downs und Baden-Baden; in den USA haben Rennen im Staat New York (Saratoga Springs), Kentucky (Kentucky Derby) und West Virginia Tradition.
Jaimy Gordon lässt uns in ihrem preisgekrönten Roman "Die Außenseiter" hinter die Kulissen eines Ortes blicken, dessen wahres Leben ganz anders aussieht. Wir sehen einen gigantischen und mitleidlosen Tanz ums goldene Kalb: amerikanischer Optimismus und Unternehmergeist, big business um Wetten und Preisgelder, wenige winners, viele losers.
Noch immer kaschiert der schöne Schein die raue Realität. Welch klingende, märchenhafte Namen die Rennpferde tragen: Little Spinoza, Gifford Grizzly, Miss Fowlerville, Railroad Joe, The Madhi ... Aber es sind abgehalfterte Klepper. Auf Indian Mound Downs, der "Ramschrennbahn" im roten Staub der Hügel West Virginias, starten Pferde, die ihre geringfügig besseren Zeiten hinter sich haben und noch ein paar Dollars einbringen sollen, ehe sie beim Abdecker einlaufen. Bei "Verkaufsrennen" werden sie mit einem Fixpreis gemeldet, zu dem sie nach dem Rennen – unabhängig von dessen Ausgang – den Besitzer wechseln werden: Pferdehandel als Glücksspiel. Wer sich nicht perfekt auskennt, wird über den Tisch gezogen.
Nicht minder abgewrackte Typen versorgen die Tiere und bereiten sie auf die Rennen vor. Da stellen sie sie in Eiskübel, schmieren sie mit Balsam ein, besprechen sie, spritzen Butolin (bute), kennen jeden dirty trick, um das letzte bisschen Potential, das in den Gäulen steckt, noch einmal zu aktivieren.
So ein Ambiente zieht zwielichtige Glücksritter an. Zocker wollen mit Wetten den schnellen Reibach machen. Mal steigt ihr Stern, mal sinkt er, und kaum gewonnen, so zerrinnt ihr Kapital auch schon wieder. Kredithaie halten sie über Wasser und leben nicht schlecht davon. In einem alten Wohnmobil haust Medicine Ed, der dunkelhäutige pferdeflüsternde Wunderdoktor, und möchte mit seinen 73 Jahren endlich aussteigen, aber noch immer hat er Schuldscheine offen stehen. Wenn gar nichts mehr hilft, bekreuzigt er sich, spricht das Vaterunser, dazu eine beschwörende Formel und bläst ein selbst gemischtes Pülverchen in alle vier Himmelsrichtungen, um das Unglück von einem Pferd abzuwenden – und meint damit auch: von sich selbst.
Auch Deucey ist nicht zu beneiden. Das verfallene lesbische Frauenzimmer nächtigt im Stroh einer Pferdebox – nicht der ungeeignetste Ort für eine Pflegerin und Trainerin, um auf die Klepper zu achten.
Unruhe kommt in diese Welt, als Tommy Hansel mit Freundin Maggie und vier Pferden anrückt, um einen großen Coup zu landen: "Schmeiß einen sicheren Gewinner ins billigste Rennen [...] und mach deinen Schnitt mit einer dicken Wette" (S. 178). So leicht wird freilich nicht jeder zum Glückspilz. Tommy mit dem irren Blick ist ein wenig meschugge im Kopf, und seine Maggie, die "bekiffte Hippieschlampe", liebt er auf rüde, erniedrigende Art. Während er immer mehr in dunklen Geschäften versinkt, wird Maggie am Schluss die einzige sein, die diesen unsäglichen Ort gescheiterter Hoffnungen und Existenzen verlässt.
Jaimy Gordon hält uns einen schwarzgefleckten Spiegel der Gesellschaft in den frühen 1970er Jahren vor Augen. Neben den Guten – Medicine Ed, Deucey, Maggie – gibt es Böse aller Schattierungen: Zocker, Kleinkriminelle, Mafia- und Möchtegern-Typen in edlen handgearbeiteten Stiefeln, die überrumpeln, intrigieren, manipulieren, korrumpieren und selbst korrupt sind. Viele von ihnen werden kein würdigeres Ende finden als die Gäule beim Abdecker. Medicine Ed und sein Pferd Pelter werden zwar weiter unterwegs sein, aber auch ihr Weg führt "nur abwärts" (S. 326).
Ein Roman für Pferdenarren und Rennsport-Insider? Naja, ein wenig Affinität zum Thema wird der typische Käufer dieses Buches schon mitbringen. Aber der Reiz der virtuosen literarischen Gestaltung wird jeden Leser faszinieren. Dem Milieu angepasst ist Gordons Sprache die des Alltags. Die Dialoge sind rau, schnoddrig, deftig, umgangssprachlich, ungepflegt. Ohne Rücksicht auf Korrektheit, gerade so, wie sie dem Sprecher aus dem Munde purzeln, fließen sie ohne Anführungszeichen in den Text ein: "Die Zeiten warn richtich hart." Übersetzer Ingo Herzke lag es am Herzen, das feeling des amerikanischen hillbilly slang zu übertragen, so gut das möglich ist.
Dazu begeistern fantasievolle Beschreibungen. Kurz vor einem Rennen "schleppten sie sich durch die Pfützen zur Startvorstellung, alle mit hängenden Mundwinkeln, außer Little Spinoza, der aussah wie ein kleiner Junge, der im Waldteich Kaulquappen fangen geht, plitsch-platsch über die regennassen Parkplätze" (S. 147). Little Spinoza geht in die Startbox, "ganz zivilisiert, wie ein Mann, der an der Garderobe um seinen Hut bittet" (S.167). Sein Jockey ist Alice Nuzum, "nicht Mann und nicht Frau, [...] nicht hässlich, aber wie zwischen Schlamm und Flusswasser geboren" (S. 162).
An seinem Agieren zeichnet sich ab, dass Tommy nicht ganz sauber tickt, psychisch gestört ist. Die Autorin unterstützt diese Charakterisierung, indem sie für einige Passagen mit der Erzählperpektive spielt – was inhaltlich etwas verstört. Da wendet sich jemand persönlich an Tommy, spricht ihn in der 2. Person an. Immer wieder taucht ein Zwilling auf: "Sie, dein Zwilling, hatte deine Seele in ihrer Obhut, in einem kleinen rosa Säckchen an die Taille geheftet" (S. 205).
Jaimy Gordon taucht tief ein in die dunkle Subkultur einer uns fremden Welt, die sie aus eigener Erfahrung kennt. Mensch und Tier analysiert sie mit einer geradezu weisen Gabe. Schon die ersten Zeilen fokussieren den Leser auf einen Mikrokosmos des Elends. Wunde Pferde bewegen sich im Kreis einer Führungsanlage, "ein jammervolles Jahrmarktskarussell, das Skelett eines billigen Fahrbetriebs, erträumt von einem Träumer, der zu müde zum Träumen ist" (S. 11). Die Aussichtslosigkeit, diesem engen Milieu jemals entkommen zu können, und die Gewissheit, als Außenseiter verdammt zu sein, bestimmen bitter und bedrückend die Atmosphäre des Romans.
 · Herkunft:
· Herkunft: