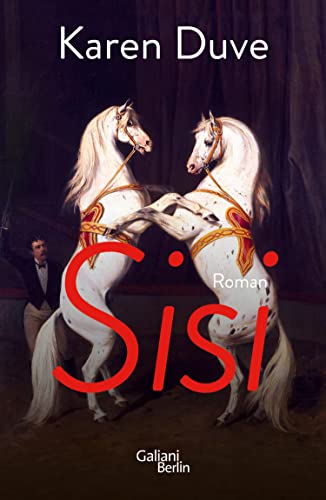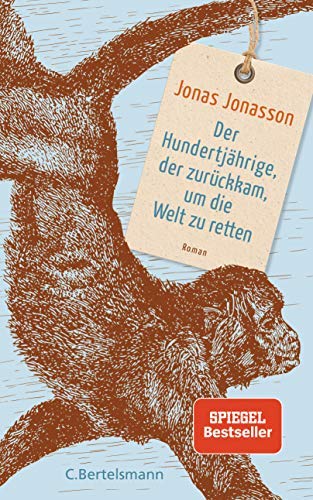Fräulein Nettes kurzer Sommer
von Karen Duve
Zwischen dominanten Männern, stickenden Cousinen, Geistesgrößen, spießigen Verwandten und rebellischen Studenten ringt das eigenwillige, kantige junge Fräulein Annette von Droste-Hülshoff um Anerkennung in einer Zeit des Wandels.
Skandal im gebirgichten Westfalen
Fast sechshundert Seiten hauptsächlich Konversationen. Eine weit verzweigte freiherrliche Sippe und ihre zahlreiche bürgerliche und blaublütige Bekanntschaft. Salons und Parks auf Landsitzen des niederen Adels und ein paar Wohnungen und Kneipen provinzieller Städte. Das alles zwei Jahrhunderte entfernt. Und dann die Protagonistin: Annette von Droste-Hülshoff, das blassgrüne, spitzgesichtige Fräulein mit den beidseitigen Zwirbellocken auf dem Zwanzigmarkschein. Wer jemals Schüler war, dem sträuben sich die Nackenhaare, wenn er an die Reclam-»Judenbuche« zurückdenkt. O schaurig war’s …
Alles ziemlich uncool also. Dass man Karen Duves neues Opus trotzdem genüsslich verschlingt, dankt man am Ende begeistert und bereichert einer Virtuosin präzisen, unterhaltsamen, gehaltvollen und hintergründigen Erzählens, die einen unerhörten Plot zu Lasten des Fräuleins in einer vermeintlich harmlos-eleganten Verpackung präsentiert.
Annette (»Nette« en famille) ist die zentrale Figur dieses Romans, der aus ihrem zwanzigsten bis vierundzwanzigsten Lebensjahr (1817 bis 1821) erzählt. Aber zu sagen hat sie nicht viel in seiner Welt, schon weil sie jung, weiblich und ledig ist. Ihr Platz ist bei den Frauen, da darf sie sticken, schwärmen, albern sein, soll sich ansonsten aber anständig benehmen und auf einen Heiratsantrag warten. Nettchen jedoch lauscht wissbegierig den Männergesprächen (das Haus ist ständig voller Besucher) und wirft ungefragt ihre Meinung ein. Dass ihre Beiträge geistreich, ihre Repliken messerscharf sind, interessiert niemanden. Dass sie aber zu schnippischen, provokanten, gar ungehörigen Formulierungen neigt, stößt auf Missfallen. Dann ärgern sich ihre mehr oder weniger gleichaltrigen Onkel und Vettern, widersprechen ihr, weisen sie zurecht oder plaudern einfach an ihr vorbei weiter, als wäre sie Luft. Sieht sie ein, allzu dreist gewesen zu sein, befallen sie Reue und Selbstzweifel, und sie zieht sich ein Weilchen ganz brav in den Käfig der Konventionen zurück – bis sie wieder der Hafer sticht.
So gilt Nette als überspanntes Wesen, weitab vom Ideal der »anmutigen Einfachheit«, und der äußere Eindruck macht sie nicht gefälliger. Sie hat extrem kurzsichtige Glubschaugen und einen farblosen Teint, »auf ihrem Hinterkopf wippte ein Vogelnest aus Zöpfen, und die Haare hinter den Ohren hingen in der Form gedrehter Hobelspäne am straff gekämmten Haupt«, sie bewegt sich »mit großen unweiblichen Schritten«, ihr Verhalten ist unkonventionell. Welches Fräulein hat man je allein mit einem Berghämmerchen losziehen sehen, um Mineralien zu sammeln?
Annette leidet selbst unter ihrer Unangepasstheit, kann und möchte sich aber auch nicht verbiegen, nur um nicht anzuecken in dem engen, komplizierten Korsett aus Erwartungen, Gewohnheiten, Vorschriften. Am unerträglichsten ist ihr, dass niemand ihre literarische Begabung erkennen will. August, fünf Jahre älter und der bedeutsamste ihrer Onkel, der überall mitmischt, als Macher, Mentor, Meinungsführer und Finanzier, verspottet offen ihre Gedichte und das Ritterepos »Walther«, die Cousinen interessieren sich für anderes, und die älteren Tanten goutieren die geistlichen Verse bloß als Gelegenheitsgefälligkeiten. Hat sie vielleicht wirklich kein Talent? Um Gewissheit zu erlangen, giert sie nach kompetenter Rückmeldung, und sei sie vernichtende Kritik.
August, der in Göttingen studiert, verkehrt in einem Kreis von Geistesgrößen und Literaten, deren anerkanntester Heinrich Straube ist. Könnte Annette diesen genialischen Menschen – ein zweiter Goethe, laut August – dazu bewegen, ihre Gedichte zu lesen, sie würde sein Urteil aufsaugen. Es bedarf vieler Monate geduldigen Abwartens, bis es endlich zu einem vertraulichen Gespräch kommt. Straube lobt Annettes Arbeit überschwänglich. Sie zeuge »von einem starken, unverwechselbaren Geist … wir werden uns alle in Ehrfurcht vor ihr verneigen«, beschwört er seinen Freund August, der nicht wahrhaben will, was seine Ohren hören.
Im Jahr darauf – 1820 – verschärfen sich die Konflikte. Der frische Wind kompetenter Anerkennung beflügelt Annette. Sie erwidert die Gefühle Straubes, ihres bürgerlichen, mittellosen, hässlichen und müffelnden Bewunderers, und es kommt zu einem unbeholfenen ersten Kuss. Während August sie zu Demut und Bescheidenheit ermahnt, ermutigt Straube sie, »weniger brav« zu sein, zu ihrer rebellischen, »wilden Seele« zu stehen. Sie gewinnt an Selbstsicherheit, Attraktivität und männlichem Zuspruch. Als der schöne, eifernd religiöse und hintertriebene August von Arnswaldt, ein weiteres Cliquenmitglied, ihr Avancen macht, fürchten ihre Onkel, sie werde ihren eigenen Ruf und den der Familie ruinieren. Sie hecken einen niederträchtigen Plan aus, um die nichts ahnende Nichte in ihre Schranken zu weisen. Die historische (wenn auch nicht in allen Details belegte) Desavouierung beendet jäh Annettes kurzes Aufblühen und wirft sie für viele Jahre aus der Bahn. Sie bleibt zeitlebens unverheiratet.
In einem kurzweiligen, frischen Stil voll leichter Ironie, die niemals den Respekt verliert, plaudert die Autorin von scheinbar unbedeutenden Ereignissen und Begegnungen. Unter der lackierten, leicht brüchigen Oberfläche freilich grummelt es, nicht nur zwischenmenschlich, sondern draußen, wo sich revolutionäre Umbrüche anbahnen, die bis in unsere Zeit wirken.
»Die Lebensverhältnisse änderten sich mit bis dahin unbekannter Geschwindigkeit«, ahnt man in Annettes Kreisen, auch wenn die Kräfte von Technik und Industrialisierung noch unterschätzt werden. Viel bedrohlicher kommt der soziale Wandel mit dem aufstrebenden Bürgertum daher, dass auf einmal Leistung, »Eigenschaften des Geistes und des Herzens« mehr zählen sollen als die Herkunft, dass die Kultur plattgebügelt werde (»Eines Tages wird es in Kassel ganz genauso aussehen wie in Hannover oder Berlin oder Paris. Und überall wird es die gleichen Dinge zu kaufen geben.«).
Einig ist man sich in der Genugtuung darüber, den welschen Tyrannen überwunden zu haben. Doch auf der Suche nach einer neuen gesamtdeutschen Identität schauen die rebellischsten Kräfte, die jungen Studenten, nicht in die industrialisierte Zukunft, sondern verschreiben sich der Reanimierung eines verloren geglaubten, besseren altdeutschen Wesens. Die Retro-Avantgarde sammelt Märchen und Volkslieder, frömmelt, flucht »Deibel ock« und »Tebelholmer« und trägt stolz den Altdeutschen Rock nebst schwingender Feder am Barett. In den Bruderschaften verbrüdern sich bürgerliche Emporkömmlinge und Habenichtse wie Straube mit jungen Adligen wie August und machen pöbelnd und prügelnd die Gassen der Universitätsstädte unsicher, so dass die Polizei einschreitet und die Gewalt eskaliert, auch bei antisemitischen Ausschreitungen. Die Ermordung des reaktionären Dramatikers August von Kotzebue durch den Burschenschafter Karl Sand (1819) führt über die Karlsbader Beschlüsse in einen umfassenden »Überwachungsstaat«. Wissend, dass damit die lustige Studentenzeit vorüber ist, hängt Onkel August »seine Altdeutsche Tracht in den Schrank«.
Derweilen darbt die Landbevölkerung in grauenvoller Armut. Während einiger ungewöhnlich kalter und nasser Jahre blieben Ernten aus, so dass viele der den adligen Grundbesitzern zu vielfältigen Diensten verpflichteten Bauern und Landarbeiter ihre Lebensgrundlage verloren und als Bettler durchs Land zogen. In eindrucksvollen Bildern – und doch aus ironischer Distanz – schildert die Autorin eine solche Begegnung. »Wie aus dem Grab gerissen« kauern geschlechtslose, schorfige Gestalten in durchnässten Lumpen im Morast und schaben, getrieben vom »Schmerz des Hungers«, wie Tiere Fleisch von einem Kadaver. Aufgefordert, die herrschaftliche Kutsche aus dem Dreck zu ziehen, siegt freilich »die lebenslange Gewöhnung an Leibeigenschaft und frommen Gehorsam über den Selbsterhaltungstrieb«, und ein paar Almosen nach getaner Arbeit lösen »eine Tränenflut und nicht enden wollende Dankbarkeitsbezeugungen« aus.
Karen Duve hat für dieses Buch jahrelang recherchiert. Breit gefächert sind die biografischen Details und Verweise auf Wissen und Wesen der Zeit. Kühn, aber glaubhaft hat sie fiktional gefüllt, was »im Dunkeln« liegt. Ihre Sprache ist präzise, bildstark (»dann strömte es wie Brei aus der Haustür«, Hausknecht Friedrich trug »einen Dreimaster auf dem Kopf«) und bisweilen frech upgedatet (»echt das Letzte«, »nicht ganz dicht«, »Mensch, jetzt hört doch mal auf mit dem Scheiß«). Unermüdlich brillant erzählt sie von den Qualen des Reisens über Land, von ein bisschen Privatsphäre bei vertraulichen Spaziergängen und von den Eiertänzen der abendlichen Gesprächsrunden über Sensibilität, gute Sitten, Verwandte und Politik. Historische Promis wie die Gebrüder Grimm oder Hoffmann von Fallersleben sind wichtige Subjekte und Objekte der Konversation, daneben flitzen andere durch die Handlung wie Alfred Hitchcock durch seine Filme: Carl Friedrich Gauß, ein Cousin des Freiherrn von Knigge, »der faule Brentano« oder Karl Drais (»der trotz wiederholter polizeilicher Verwarnung mit seiner zweirädrigen Laufmaschine mal wieder auf dem Gehweg gefahren ist – und das mit einem Affenzahn«). Ein Höhepunkt sind die Kapitel über das Kuren in Bad Driburg, wo Annette an den haarsträubenden Auffassungen des Kurarztes über die weibliche Konstitution und an den engen Fesseln gesellschaftlicher Konventionen schier verzweifelt.
Sehr cool das alles!
 Bücher und Musik für Advent und Weihnacht
Bücher und Musik für Advent und Weihnacht
 · Herkunft:
· Herkunft: