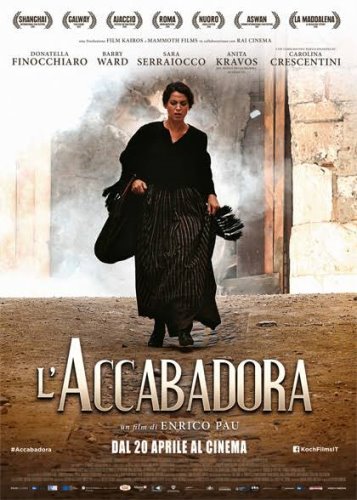L’uomo che comprò la Luna
von Paolo Zucca
Was zunächst daherkommt wie eine kurzweilige, verschmitzte Persiflage auf all das, was seit Jahrzehnten als „typisch sardisches Kulturgut" hochgehalten, überhöht, stilisiert, dramatisiert, auch kritisiert wurde, erweist sich schließlich als tiefgründige Liebeserklärung an Sardinien.
Per aspera ad lunam
Dass Paolo Zucca einen eigenwilligen, kräftigen Humor hat, hat er schon mit seinem ersten Film hinreichend bewiesen (»L’arbitro«, 2013, › Rezension). Im Jahr 2018 hat er mit »L’uomo che comprò la Luna« noch eins draufgesetzt und sein Thema vom Fußball in den Weltraum erweitert, ohne Sardinien zu verlassen. Es ist ein Film, dessen Handlung von einer großen Aufgabe erzählt und einen neuen Blick auf alte Welten wirft.
Die Aufregung unter den internationalen Regierungschefs ist groß, als bekannt wird, dass der Mond – unzweifelhaft Gemeinschaftsgut der Menschheit – zu Privateigentum geworden sei. Zwei italienische Geheimdienstler haben Wind davon bekommen, dass ein Bürger Sardiniens unseren Trabanten erworben habe. Vor allem die Amerikaner können solch einen dreisten Anspruch auf ihre »Entdeckung«, noch dazu aus provinzieller Ecke, natürlich keinesfalls durchgehen lassen. Die beiden Agenten sollen also einen Experten anheuern, um die Angelegenheit aufzuklären, und es gelingt ihnen, Gavino Zoccheddu anzuwerben, einen jungen Mann mit sardischen Wurzeln, die er sich jedoch brutal amputiert hat. Er ist nach Mailand gezogen, hat sich den dortigen Akzent, die Alltagskleidung und einen blonden Haarschopf übergestülpt, und indem er sich Kevin Pirelli nennt, verrät außerhalb seiner Seele nichts mehr seine insulare Herkunft.
Um ihn für seinen großen Auftrag fit zu machen, muss seine wahre Natur der sardità wieder freigelegt werden, und das soll ein Lehrer bewerkstelligen, wie man auf der Leinwand noch keinen gesehen hat. Badore ist ein Typ wie ein uralter Ziegenbock, Sarde (was sonst?), ein vierschrötigerSturkopf, ein stämmiger Grobian mit hermetischer Mimik, dessen unorthodoxe Lehrmethoden inklusive scharfem Ton und Schlagkraft uns erheitern, verblüffen und aufklären, bei Kevin/Gavino aber verschüttete Wahrheiten freilegen. Auf die harte Tour lernt der, (wieder) zu sprechen, zu handeln und zu denken wie ein unverfälschter Sarde. Für korrekten Auftritt sorgen hohe Lederstiefel, Bundhosen, Schlägermütze coppola, für maskuline Akzeptanz minimalistische Ausdrucksweise, Wildschweinschießen, Billiard, Tischfußball und das atemberaubend schnelle Morra-Spiel (ähnlich »Schere, Stein, Papier«), bis er (nachgewiesen durch eine tückische Prüfung) fit ist für seine Mission.
Indem sich Kevin/Gavino nun mit den unterschiedlichsten Fortbewegungsarten (darunter »la corsa del latitante«) über seine Heimatinsel bewegt und die merkwürdigsten Abenteuer bestehen muss, wird der pikareske Held mit einigem von dem konfrontiert, was seit einem Jahrhundert literarisch beschrieben und nach dem Krieg anthropologisch und soziologisch erforscht wurde, ehe es vielfach zu Stereotypen und Klischees erstarrte und auch persifliert wurde, von der Engstirnigkeit der Hirten und ihrer Ehrpusseligkeit, von ihrer monatelangen Einsamkeit und den gemunkelten Funktionen der Schafe dabei, von der eigentümlichen Tracht, dem durchdringend-kehligen Cantu a tenore, den engschrittigen Rundtänzen und umso kühneren Pferderennen, schließlich von der unvermuteten Stärke der Frauen, die hier Königinnen sind.
Eine rasante, bunte Mischung aus Elementen diverser Genres und Stile verleiht dem Film die Leichtigkeit, mit der er spielend die Sympathie der Zuschauer gewann (und überraschende Einnahmen erzielte). Cineastisch schöpft er aus Western, Roadmovie, Science-Fiction und Slapstick, literarisch aus Komödie, Satire und Märchen, stilistisch kann man Lyrisches ebenso wie Surrealismus, Anarchie und Nonsense entdecken. Wie schon in »L’arbitro« fallen ballettähnliche Passagen auf, worunter man auch die markante Emblematik rechnen darf, die eine Ape Piaggio mit einem (eher stoischen statt störrischen) Esel konfrontiert.
Die Handlungsführung lässt keinen Zweifel daran, dass es mit der lustigen, bisweilen albern anmutenden Oberfläche von Gags keineswegs getan ist. Die Reifung von Kevin zu Gavino, vom heimat- und gesichtslosen Emigranten zum Sarden ist eine Reise nach Innen unter Anleitung. Es geht dabei um die Wiederentdeckung und Wiederaneignung der Jahrtausende alten Kultur und Geschichte und des Wertesystems, das der junge Mann zwar noch von seinem Großvater kennt, aber ablegte – wodurch er sich verloren hat. Je sicherer er sich auf sardischem Terrain (wieder) fühlt, desto weniger braucht er sich durch Übertreibung des Machotums zu beweisen, desto überzeugender wird er zum wahren Sarden, wie ihn Bardone definiert (und selbst repräsentiert): »un uomo che mantiene le promesse e capisce la differenza fra le persone e le cose«. Was da zählt, sind altbewährte menschliche Tugenden wie Respekt, Loyalität, Teilen, Dankbarkeit, und eigenartigerweise empfindet man hinter allem (einschließlich der hohlen Großmäuligkeit) eine verhüllte Schwermut.
Im zweiten Teil verdichtet Zucca die psychosozialen und philosophischen Aspekte, und der Film gewinnt durch eine poetisch-metaphysische Ader eine tiefere Dimension. Schon in seinen Anfangslektionen wird Kevin/Gavino daran erinnert, dass die Sarden nach dem Tod nicht ins Jenseits, sondern auf den Mond ziehen, und eine traumähnliche Szene bringt ihm jetzt vor Augen, wie bedeutende Frauen und Männer aus der langen sardischen Geschichte (Ampsicora, Eleonora d’Arborea, Giovanni Maria Angioj, Grazia Deledda, Antonio Gramsci …) dort würdevoll mit gewöhnlichen Hirten, Bäuerinnen, Bergarbeitern, Alten weiterleben.
Was es mit der verwunderlichen Besitzergreifung unseres nächsten Himmelskörpers durch einen Sarden auf sich hat, soll hier nicht verraten werden – nur so viel: Es hat mit Raumfahrt nichts zu tun, aber viel mit tiefer Menschlichkeit.
»L’uomo che comprò la Luna« auf YouTube suchen
»L’uomo che comprò la Luna« auf unserer YouTube-Playlist suchen
 · Herkunft:
· Herkunft: