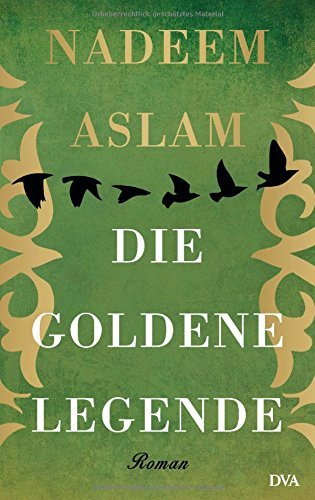Tyll
von Daniel Kehlmann
Im Dreißigjährigen Krieg zieht ein schwer durchschaubarer Schelm durch die Lande, amüsiert und provoziert die geschundenen Leute und selbst den Kaiser mit galligem Humor. Ein Panoptikum illustrer Persönlichkeiten und Phänomene der Zeit und ein Spiel mit unseren Gewissheiten.
Ein literarischer Tanz auf dem Seil
Glauben Sie ihm nichts, diesem Erzähler. Sein Autor treibt sein Spiel mit der Historie, der Realität, der Wahrheit und mit uns. Und seine Geschöpfe, die Figuren dieses Romans, sind aus dem gleichen Holz geschnitzt.
Aber so unterhaltsam, klug und reizvoll ist das Spiel, dass Sie sich gern an der Nase herumführen lassen werden.
Der Dreißigjährige Krieg, die Auseinandersetzung zwischen Katholizismus und dem jungen Protestantismus, verwüstete Zentraleuropa. Vor allem die Landbevölkerung wurde, wenn nicht ihres Lebens, dann ihrer Lebensgrundlagen beraubt. Den historischen Rahmen lässt unser Autor unangetastet. Er beschreibt einige Schlüsselereignisse, einige VIPs der Zeit treten in persona auf, einige Gräueltaten lassen uns schaudern, aber sie stehen nicht im Zentrum.
Im Zentrum stehen die einfachen Leute, ihr Wesen, ihr Alltag in einer Epoche, deren bittere Last sie tragen, ohne ihre Bedeutung durchschauen, geschweige denn beeinflussen zu können. Im Zentrum steht Tyll, die Titelfigur, und mit ihr fängt Kehlmanns Flunkerei an. Natürlich spielt sie an Till Eulenspiegel an, den Schalk aus dem Volksbuch-Weltbestseller von 1510 oder 1515, der die Schwächen seiner Mitmenschen bloßstellte, indem er ihre Redewendungen für bare Münze nahm. Wenn er je gelebt hat, so mag er um 1300 in Kneitlingen geboren und 1350 in Mölln gestorben sein.
Tyll hat mit dem dreihundert Jahre älteren Schelm nicht viel zu tun. Er ist eine erheblich komplexere Persönlichkeit, hat eine richtige Biografie und reißt gar nicht so viele Possen. Eher erweist er sich als zynischer Provokateur und Kommentator. Nach Einschätzung seines Schöpfers ist er eine »dämonische« Gestalt.
Tylls Nährboden ist eine Welt, die aus den Fugen gerät, der Aufbruch vom beharrlichen Mittelalter in die ungewisse Neuzeit. Sein Vater Claus steht exemplarisch für die erwachende Neugier, die von den alten Kräften erstickt wird, für die Vernunft, die noch machtlos ist, wenn sie mit Glauben und Aberglauben bekämpft wird. Claus interessiert sich – mehr als für seine Arbeit als Müller – für Naturphänomene: die Eigenschaften der Kräuter, der Lauf des Mondes, die Zeit. Mit seinen Erkenntnissen und mit Zauberformeln kann er leichte Krankheiten heilen. Die Leute sind ihm zunächst dankbar, doch dann wird er ihnen unheimlich, und sie machen ihn als Schuldigen für allerlei Schicksalsschläge aus. Wie sollten sie wissen, dass Missernten und Hungersnot klimatisch bedingt waren?
Den Garaus machen Claus zwei durchreisende Gelehrte, von denen er sich Hilfe beim Verstehen eines lateinischen Buches erhofft. Aber da ist er an die Richtigen geraten: Das Buch ist verboten, die beiden sind Jesuiten, und so ist es um das Leben des Mannes geschehen. Das Verhör ist ein Glanzstück Schwindel erregender argumentatio, die zwischen zurechtgebogener Theologie und hanebüchenen Bezügen zu Magie, Zauberei und den Heilkräften von Drachenblut irrlichtert, um perfide Vorwürfe zu untermauern.
Jetzt muss Tyll aus seiner Heimat fliehen, aber den aufgeklärten Geist seines hingerichteten Vaters führt er im Gepäck. Mit der jungen Bäckerstochter Nele schließt er sich er sich einer Gauklertruppe an – fahrendes Volk, vogelfreie, rechtlose Hungerleider, aber frei. In den Dörfern, wo marodierende Banden täglich den Tod bringen können, lassen die Entertainer einen Nachmittag lang das Elend und die vielfältigen Bedrohungen vergessen. Die Attraktion der derben Streiche, die Tyll auf Kosten der Zuschauer macht, mischt sich mit der seiner Person: Tyll ist aus einer anderen Welt, ist einer, der »tut, was er will, ... nichts glaubt und keinem gehorcht«. Beneidenswert! »Wir begriffen, dass wir nie solche Menschen sein würden«, sagt der uns unbekannt bleibende Erzähler.
Dabei amüsieren seine Schelmenstücke am meisten Tyll selbst. Vom Knecht bis zu den Handwerkern, die »sich immer für was Besseres hielten«, stehen alle Dörfler unter seinem Bann, gehorchen wie hypnotisiert seiner Aufforderung: »Zieht eure Schuhe aus ... Jeder den rechten ... werft ihn hoch ... das wird ein Heidenspaß!« Ist das Chaos perfekt, heizt Tyll die Stimmung an, beleidigt die »Deppen«, die sich, jeder auf der Suche nach seinem Eigentum, in einen prügelnden Haufen Zwietracht verwandeln. Endlich entlädt sich der Hass, den sie schon so lange in sich trugen, »dass sie die Gründe nicht mehr wussten«. Ehe seine Zuschauer (Opfer? Patienten?) wieder zu Sinnen kommen, macht sich Tyll davon, denn »wenn du schneller läufst als die anderen, kann dir nichts passieren«.
Bei Kehlmann darf Tyll Karriere machen. Wie ein Springteufel taucht er mal hier, mal dort auf, und auch höchsten Kreisen hält er den Spiegel vor. Der pfälzische Kurfürst und Protestant Friedrich V. ist zwar frisch zum König von Böhmen gewählt, doch davon hat er nichts, denn sein Gegner, der katholische Habsburger-Kaiser, ist übermächtig. Schon nach einem Jahr ist Friedrich nicht nur die Krone, sondern auch seine Kurlande los und wird fortan als »Winterkönig« verspottet. Seine Politik treibt Europa in den Krieg. Tyll begleitet auch Friedrichs Gemahlin Elizabeth, Mary Stuarts stolze Enkelin, bei ihren demütigenden Unternehmungen, ihren Gatten wieder in seine verlorenen Würden zu setzen.
Viele Jahre später streckt sogar der Kaiser seine Hand nach dem »berühmtesten Spaßmacher« aus. Auch wenn man nicht wisse, ob er Protestant oder Katholik sei, sei so einer etwas »Unschätzbares«, das bei all der Zerstörung nicht verderben solle. Graf Wolkenstein (ein Nachfahre Oswalds, des Minnesängers und Diplomaten), schreibt als alter Mann seinen Bericht, wie er damals Tyll Ulenspiegel im Kloster Andechs aufspüren und nach Wien schaffen sollte. Da erweist sich historische Realität als relativer Begriff. Kühn behauptet der von allerlei Gebresten geplagte Graf, dass alles »genauso war«, wie er es schildere, und beklagt gleichzeitig Lücken in seiner Erinnerung. Um die Leerstellen zuzukleistern, mischt er souverän Verbürgtes, dreist Erfundenes und mit der Zuverlässigkeit der Flüsterpost Weitergereichtes. Gezielte Stilisierung der literarischen Sprache – »blumige Abschweifung«, »kunstvoll verschachtelte Sätze« – soll seine Unsicherheit kaschieren. Gerade die effektvollsten Passagen sind »erlogen«.
In der Schlacht bei Zusmarshausen etwa, der letzten und verlustreichsten des Dreißigjährigen Krieges, hat Tyll dem Wolkenstein das Leben gerettet. Die Bilder haften noch in des Grafen Erinnerung, ohne sich in Sprache gießen zu lassen. Warum nicht einfach abschreiben aus dem Bestseller »Der Abentheuerliche Simplicissimus Teutsch«? Wen stört's, dass Grimmelshausen über die Schlacht von Wittstock, obwohl Augenzeuge, auch nichts zu Papier bringen konnte und seine Beschreibung deshalb von Martin Opitz abkupferte, der freilich »nie im Leben bei einer Schlacht dabei gewesen war« und seinen Bericht aus einem englischen Roman entlieh, den er selbst übersetzt hatte?
Wie Wolkenstein und Tyll jongliert auch Kehlmann kunstvoll mit Fiktion und Realität (Das hat er schon in seiner »Vermessung der Welt« mit Humboldt und Gauß getan.). Barockdichter Paul Fleming schaut vorbei, auch Dr. Athanasius Kircher, historisch ein vielseitig aktiver Universalgelehrter, hier aber zum Scharlatan degradiert. Sein britischer Begleiter Oswald Tesimond, ebenfalls Jesuit und irgendwie in den Gunpowder Plot involviert, forscht nach dem letzten wahren Drachen, den er in Holstein vermutet. Ratio und Aberglauben koexistieren gleichberechtigt, beide vereint in den »Hexen-Commissarii«, die ihrer heiligen Pflicht nachgehen, »das kapitale Supplicium der Malifikanten an Ort und Stelle vorzunehmen«, sprich »Armesünder« auf den rechten Weg, de facto auf den Scheiterhaufen zu geleiten. .
Wie die Wunderkammer eines Renaissance-Fürsten versammelt Kehlmanns lebenspraller Roman kuriose Raritäten, Preziosen und Absonderlichkeiten, der Natur oder dem menschlichen Geist entsprungen. Dazu gehören intellektuelle Herausforderungen wie Palindrome (oder gleich deren Extremform, das »magische Quadrat«) und die Frage, welches Körnchen in einem Haufen dasjenige ist, das die Ansammlung zum »Haufen« macht.
Auf die naheliegende Versuchung, die Grausamkeiten des Krieges auszumalen, fällt Kehlmann nicht herein. Er lässt aber erkennen, wie sie sich ins Alltagsleben einschleichen – wie etwa ein Dragoner so ganz nebenbei den Kopf einer Gans mit einem Schuss in Nichts auflöst. »Obgleich der dicke Graf bald darauf noch viel mitansehen würde, sollte er sein Lebtag nicht vergessen, welch ein Schrecken ihn bis ins Innerste durchfuhr, als der Kopf des Vogels platzte.« Auch mancher Dialog lässt Verrohung und Mitleidlosigkeit erkennen (»Ich reiß ihm die Ohren ab. Ich schneid seine Finger weg. Ich verbrenn ihn«).
Mit seinem Medium Tyll, aus einer anderen Zeit hierher verpflanzt, ist Kehlmann ein literarisches Meisterstück gelungen. Er eröffnet den Blick tief in die Seele einer verworrenen, fehlgeleiteten Zeit voller Grauen, aber es ensteht ein Vexierbild, ein Spiel mit Realität und Fiktion, mit Historie und Fantasie, mit Faktischem und Geheimnisvollem.
Das Fundament von Kehlmanns Stil ist die unkompliziert fließende Syntax, das unprätentiöse, vielschichtige Vokabular, die messerscharf treffende Wortwahl, die gekonnt effektorientierte Strukturierung. Für Leichtigkeit und ästhetischen Reiz sorgt sein Sinn fürs Spielerische, fürs fein Amüsante, für leichte Ironie, für das Ungewöhnliche im Gewohnten, für Humor, wenn es am ernstesten wird. Sepp, der Knecht, rächt sich für einen üblen Streich, indem er Tyll in den Mühlbach wirft, und dem Kind schießt im Fallen durch den Kopf, »wovor er sein Leben lang gewarnt worden ist: Steig nicht vor dem Rad in den Bach, geh niemals vor dem, geh vor dem Mühlrad nicht, auf keinen Fall geh nie, nie, geh nie vor dem Mühlrad in den Bach!«
Dieses Buch – ein großes Lesevergnügen für literarische Gourmets – habe ich in die Liste meiner 20 Lieblingsbücher im Frühjahr 2018 aufgenommen.
 · Herkunft:
· Herkunft: