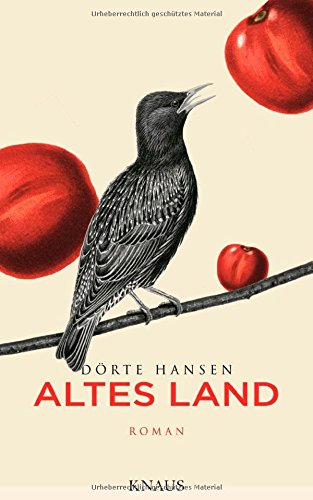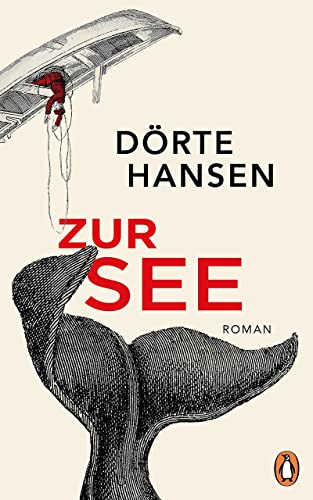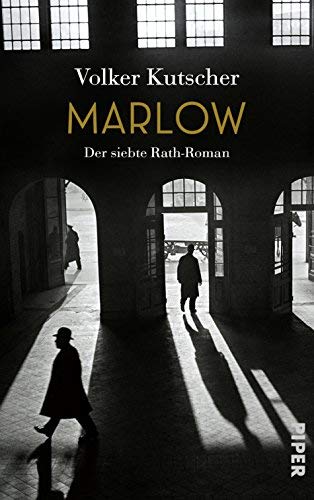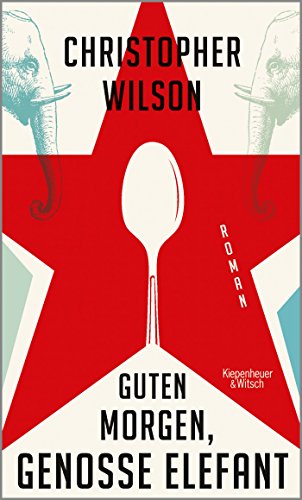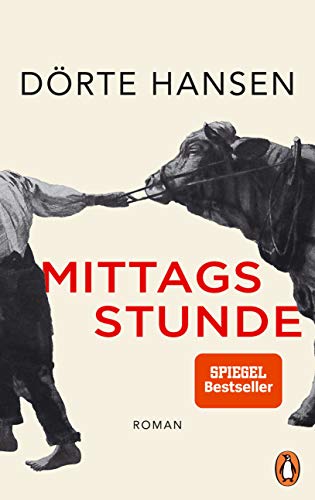
Mittagsstunde
von Dörte Hansen
Von der Abschaffung des Gewohnten, der Melancholie des verlorenen Heimatgefühls und der Suche nach Neuorientierung erzählt Dörte Hansen in ihrem modernen Heimatroman ohne Klischees und ohne Rührseligkeit, dafür mit einer Sprache, die durch Humor, Bilder, Aufrichtigkeit und Herzenswärme besticht.
Brinkebüll ist abgeschafft
Was bewegt Dr. Ingwer Feddersen, 47, Archäologe an der Uni Kiel, dazu, ein Sabbatjahr einzulegen, um in den Ort seiner Kindheit und Jugend zurückzukehren? Und wie ging es zu vor drei Jahrzehnten in Brinkebüll, dem fiktiven Dorf im Geestland nahe Husum, aus dem er stammt und das stellvertretend für viele andere der Epoche steht? Zwischen den beiden Zeitebenen der Handlung – Gegenwart und Siebzigerjahre – springt Dörte Hansens Erzählung hin und her und breitet ein detailreiches, lebenspralles, buntes, nachdenklich stimmendes Sittengemälde aus.
Zweieinhalb Jahrzehnte hat Ingwer Feddersen in einer »angestaubten Wohngemeinschaft« in einer Kieler Villa zugebracht und endlich erkannt, dass das unsortierte Leben nicht seine Welt ist. Wie soll es jetzt weitergehen mit ihm? Er hat viel gutzumachen, glaubt er. Er habe Verrat an seiner Familie, an seiner Heimat begangen. Wie soll es weitergehen mit seinen pflegebedürftigen Groß- und Ersatzeltern, die er liebevoll Vadder und Mudder nennt?
Damals in Brinkebüll herrschten klare Regeln. Eine von ihnen betraf die »Mittagsstunde«, in der sich der Vater, wenn er von der Arbeit gekommen war und sein Mittagessen serviert bekommen hatte, aufs Ohr legte, um danach gekräftigt an seinen Arbeitsplatz zurückzukehren. Für ein, zwei Stündchen versank »das betäubte Dorf« in eine Siesta-Starre, während der kein Kind wagte, auch nur eine knarzgefährdete Treppenstufe zu betreten.
Darum herum aber war das Dorfleben durchaus turbulent, und in seinem Mittelpunkt stand der alte Gasthof, den Ingwers Großeltern Sönke und Ella Feddersen führten, mit Frühschoppen am Sonntag, Jubiläen, Hochzeiten und Trauerfeiern, wie sie sich gehörten. Der Umbruch begann im Sommer 1965, als drei Ingenieure ins Dorf kamen, um das Land für die Flurbereinigung zu vermessen. In ganz Deutschland wurden damals die über Jahrhunderte vererbten, zersplitterten und verstreuten Äcker neu verteilt, so dass wirtschaftlicher zu bearbeitende große Flächen entstanden.
So einleuchtend das Konzept, so schwierig die Folgen. Die nun beginnende radikale Ökonomisierung der Landwirtschaft ersetzte, wenn es gut lief, die Höfe der Großbauern durch Agro-Fabriken, und wenn es nicht gut lief, reduzierte sie die kleineren Bauern zu Erwerbslosen. Mit den Ex-Landwirten wanderte auch die Infrastruktur ab – der Dorflehrer, Tante Emma, Herr Pfarrer, der Postbote, der Kneipenwirt und der Herr Doktor zogen mit ihrer Klientel in die Städte. Einst lebendige Dorfgemeinschaften verkümmerten bis auf den harten Kern der überlebenden Agrarmanager. Zurück blieben plattgebügelte Landstriche mit endlosen, verödeten Ackerwüsten.
Die Vermesser hinterließen nicht nur ein zerstrittenes Brinkebüll, sondern auch eine Frucht der Liebe im Leib der siebzehnjährigen Feddersen-Tochter Marret. Die war immer schon »verdreiht … ein Knäuel Mensch, verfilzt, schief aufgerollt«, mit der Schwangerschaft aber endgültig durch den Wind. Sie geistert als kuriose Vogelscheuche durchs Dorf, sieht überall Zeichen einer nahenden Apokalypse, auch in den Streifen, die die in der Nähe stationierten Bundeswehr-Starfighter in den Himmel schreiben. Aber die Dörfler schubsen niemanden wie Marret über den Tellerrand, man »nahm sie hin wie Löcher in den Straßen«.
Von ihrem Söhnchen will »Marret Ünnergang« nichts wissen, weswegen sich die Großeltern seiner annehmen und ihm liebevoll alles Menschenmögliche angedeihen lassen, damit »wat halfwegs Normales« aus ihm werde. So wie Sönke den »Dorfkrug« ganz selbstverständlich von seinem Vater übernommen und sein Leben hinter der Theke verbracht hatte, steht für ihn fest, dass Ingwer in seine Fußstapfen treten werde. Der kleine »Kümmerling« aber hat »de Nääs in de Böker«, buddelt »Steine und kaputte Töpfe« aus, verlässt das Dorf, macht Abitur und legt eine akademische Karriere hin. Derlei freilich verachtet Sönke und kann sich im Übrigen bis heute nicht erklären, »was da schiefgelaufen war«.
Jetzt ist Sönke ein »sturer Findling«, der trotz seiner 93 Lenze, Arthrose und einem blinden Auge auf seinem Platz hinter der Theke beharrt – umso stärker, als er sich an die zerfasernde Welt seiner dementen Ella noch nicht gewöhnt hat. Nur »E-Bike-Pärchen oder Hünengrab-Touristen« verirren sich noch in die Gastwirtschaft. Sie bestaunen den grünen Sparclubkasten und die verstaubte Wurlitzer-Musikbox, machen ein Handyfoto von dem krummen, geschrumpften Wirt und klopfen ihm beim Bezahlen auf die Schulter, als wäre er »ein altes Zirkuspferd«.
Immer wieder einmal ist Prof. Dr. Feddersen am Wochenende von Kiel nach Brinkebüll gefahren, um in der Wirtschaft und auf dem Hof zu helfen. Dann hat er im Auto die Neil-Young-CD mitgesungen, deren wimmernder Sound ihn moralisch stärkte: »Don’t let it bring you down«. Draußen sah er die menschenleere Geest, von Gletschereis poliertes Altmoränenland. »Man hatte hier als Mensch nicht viel zu melden. Man konnte … gegen den Wind anbrüllen … Flüche in den Regen schreien, es brachte nichts.« Er liebte seine Heimat, »wie man an einem abgeliebten Stofftier hing«, und ihre Menschen (»Nordseegesichter, das Profil von Westwind abgeschliffen. Nichts ragte vor, nichts stach heraus, man übersah sie leicht.«) und bemerkte die Veränderungen der Landschaft (gigantische Maisfelder, aus denen »Solaranlagen oder Windturbinen wuchsen«) und der Lebensweise.
Von diesen Zeitläuften erzählt der Protagonist, eifrig kommentiert von der auktorialen Stimme der Autorin. Die schickt jedem der 22 Kapitel den Titel eines zum Inhalt passenden Gassenhauers voraus: »Oh Lord, won’t you buy me a Mercedes Benz«, »Schuld war nur der Bossa Nova«, »Völker, hört die Signale«, »Junge, komm bald wieder« singen wir Leser im Mute-Modus mit. Eigenartig, wie uns auch die Sprache lebendig und mit vielen dialektalen Farben in den Ohren erklingt, obwohl Dörte Hansen kaum direkte Rede einsetzt. Stattdessen fließt ihr ein munter sprudelnder, glasklarer, farbig funkelnder Erzählfluss aus der Feder, der das Dorfleben in Brinkebüll mit seinen knorrigen, eigenartigen, fest verwurzelten Menschen »in fossiliertem Kleidungsstil« plastisch und detailreich auf unsere innere Leinwand projiziert und die Geschichte ihrer schmerzlichen Verluste ohne Sentimentalität vor Augen führt. Wie sie sehen wir nicht nur Kopfsteinpflaster und Kastanienallee verschwinden, hängen in Gedanken dem strengen Lehrer Steensen nach, der seinen Zwergschul-Zöglingen die Sprache der Bauerntölpel, das Plattdeutsche, auszutreiben suchte, und schauen nachdenklich auf die »Kapuzenkinder« in den Wartehäuschen der Bushaltestellen, wie sie »wie kleine Saatkartoffeln aus dem sandigen Boden gerüttelt und […], damit aus ihnen mal was würde«, täglich Dutzende Kilometer ins Gymnasium gekarrt werden.
Das Bild, das Dörte Hansen zeichnet, ist trotz zahlreicher Dönekes und eines heiteren Grundtons zutiefst menschlich und hintergründig. Nicht alles ist dazu da, einfach nur nostalgisch beschmunzelt zu werden. Literarisch nachhaltig beeindruckend schreibt die Autorin über den Themenkreis Pflege und Sterben. So fragil Sönkes und Ellas Körper geworden sind (»wie kleine Knochenbündel, die in alten Reisetaschen lagen«), so entschieden kämpfen beide um jeden Tag ihrer Selbstständigkeit. Dennoch bleibt ihnen nichts anderes übrig, als sich helfen, sich fallen zu lassen. Anrührend, wie schwer es Sönke, der seit Jahren keine Berührung mehr gespürt hat, fällt, jetzt seine Scham abzulegen – »ein Fluchttier, das sich langsam an die Menschenhand gewöhnen musste«. Dörte Hansen spart nichts aus in den Szenen der täglichen Unachtsamkeiten, der kleinen und großen Malheure, in denen Ingwer seine Großeltern versorgt, aber niemals verlieren die Menschen ihre Würde.
Was Ingwer Feddersen nach Brinkebüll treibt, ist nicht Nostalgie. Es ist Trauer über das Verschwinden einer Lebensweise, einer Kulturform, der bäuerlichen Zeit, die seine Heimat war. Heute wiegt der Verlust schwerer denn je, und mehr Menschen denn je sind sich seiner bewusst, nicht nur in den Städten. Brinkebüll ist längst verdorrt, aber jetzt wieder begehrt. Die Einwohner des Heute auf der Suche nach emotionaler Erholung wollen Navi-Ziele und idyllische Strecken für E-Bike-Touren, und so boomen reanimierte Dorfromantik und Folklore-Imitate: Leberkäs und Landbier unter Linden, Hofläden in dekorativ vergammelten Scheunen, Heimatromane am Bachufer. Die Städter schwärmen von Pferdehöfen, wo niemand auf die Idee käme, im Märzen die Rösslein einzuspannen, solange Töchterchen und Gattinnen das Glück auf dem Rücken der Pferde ausleihen.
Dieses Buch habe ich in die Liste meiner 20 Lieblingsbücher im Herbst 2018 aufgenommen.
 · Herkunft:
· Herkunft: