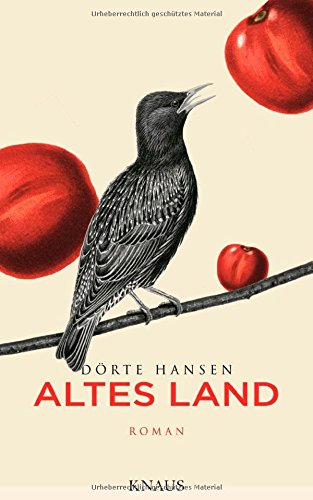Zur See
von Dörte Hansen
Kühne Befahrer der Weltmeere sind sie schon lange nicht mehr. Doch die Erinnerung an große Zeiten haben die Bewohner der Nordseeinseln umzumünzen gelernt. Jetzt strapaziert der fortgeschrittene Strukturwandel den Gemeinschaftssinn, und der Spagat zwischen dem Fortleben alter Eigenschaften und den Ansprüchen des Tourismus droht sie zu zerbrechen.
Gekenterte Walfänger
Überraschend andersartig ist der Inhalt von Dörte Hansens drittem Roman. »Zur See« begeistert mit einem Familienplot in einer überschaubaren nordfriesischen Inselwelt, die dem Untergang geweiht scheint. Der Tourismus, von den wortkargen, anspruchslosen Menschen dort anfänglich als segensreiche Abwechslung in der Eintönigkeit ihrer begrenzten Heimat begrüßt, hat sie inzwischen wie ein Tsunami in Zeitlupe überflutet, ihr Leben umgekrempelt, entwurzelt. Die Ursachen und Auswirkungen seziert die Autorin in ihrer bekannten meisterlich präzisen, schlichtweg faszinierenden Sprache, die 250 Seiten lang ohne einen Dialog auskommt, aber übervoll ist von bildprallen Formulierungen, die das Vorstellungsvermögen der Leser permanent inspirieren, herausfordern, bereichern. Dörte Hansen, 1964 in Husum geboren, weiß, wovon sie erzählt. Sie hat ein tiefes Verständnis des Menschenschlags, ihr Herz schlägt für die Bewohner, und unseres kann nicht anders als es ihm gleichzutun.
Schauplatz des Romans ist ein nicht näher benamtes Eiland – es steht stellvertretend für wohl alle Nordseeinseln. Die ungenaue Verortung ist ein Stilmittel, das sich wiederholt – »irgendwo in diesem Haus«, »Auf allen Inseln gibt es einen, der die Sagen kennt.« – und schon der erste Satz sagt: »Auf einer Inselfähre, irgendwo in Jütland, Friesland oder Zeeland, gibt es einen, der die Leinen los- und festmacht, und immer ist er zu dünn angezogen für die Salz- und Eisenkälte eines Nordseehafens.«
»Zur See« erzählt von der Gemeinschaft der Inselmenschen. Nachbarn und Verwandte sind seit Jahrhunderten Augen- und Ohrenzeugen intimsten Erlebens. »Man kann sich hinter Knochenzäunen nicht verstecken.« Geheimnisse können keinen Bestand haben. Man teilte ähnliche Schicksale: wochenlanges Warten auf die Männer, die zur See fuhren, Erinnerungen an die »Ertrunkenen, von einem Mast Erschlagenen, Verschollenen, Erfrorenen und an Skorbut Gestorbenen«, »Chroniken des Wartens und Alleinseins, der Winterhochzeiten, des Kindersterbens und der Witwenschaft, vermutlich eingestickt in Taufkleider und Bettbezüge, eingenäht in Trachtensäume, eingeklöppelt in die Spitzendecken, für die Töchter«.
Die rauen, unberechenbaren tempi passati, die bangen Ängste leben fort im Gemüt der Menschen, doch das, was einstmals so etwas wie Ordnung und Ruhe in ihr Leben gebracht haben mag, ist dahin. Mit der ungeahnten Touristenflut ist die moderne Zeit über die einst isolierten Inseln hereingebrochen und hat Probleme ganz anderer Art angeschwemmt. Der sogenannte Strukturwandel hat das Eigenleben der »Inselleute« zum Beispiel an die Randstunden ihrer Tage abgeschoben – nur morgens, bis der Ansturm der Fremden hereinbricht, und abends, wenn die Tagesgäste wieder weg sind, können sie sie selbst sein.
Im Mittelpunkt des Plots steht die Familie Sander. Mutter Hanne, Vater Jens und ihre erwachsenen Kinder Ryckmer, Eske und Henrik bewohnen das schönste Haus im Dorf. Es ist sorgsam restauriert und ausgestattet, hat niedrige Decken und natürlich ein Reetdach. Was für eine Idylle! Doch nach kaum zehn Seiten ist der schöne Schein schon zerbröselt. Die tüchtige Hanne tut ihr Bestes, sie kennt keinen Stillstand, sie ist auf alles vorbereitet, sie hortet Lebensmittel für ein halbes Jahr. Folglich kann sie auch nichts schrecken. Verhindern kann auch sie nicht viel.
Ryckmer beispielsweise, das älteste der Kinder, war einmal Kapitän eines großen Tankers. Was damals geschah, möchte er endlich vergessen. Dann ist er wieder zu Hause eingezogen, wurde zum Deckmann auf der Inselfähre degradiert und gibt mit seinen Messingknöpfen an der Jacke und Ring im Ohr den grimmigen alten Seebären für die Fremden. Am Abend und an den Wochenenden betäubt er sich bis zum Delirium. Hanne sorgt dafür, dass er nicht völlig verkommt, morgens einigermaßen nüchtern seinen Dienst auf der Fähre antreten kann, aber mehr als das Notwendigste tut sie nicht.
Das Zerreißen der Familie Sander setzte mit dem Eintreffen der ersten »Badegäste« in den Siebzigerjahren ein. Die meisten bleiben mindestens zwei Wochen, spielen in der »guten Stube« Karten mit den Beherbergern, schreiben zu Weihnachten Karten, kehren jeden Sommer wieder und entwickeln sich so zu zahlenden Wahlverwandten,
Aber auch die Gastgeber müssen einen Preis zahlen – und keinen geringen. Dass alle mithelfen müssen, die Lasten von Juni bis August zu tragen, ist für Hanne eine Notwendigkeit, aber kein Problem. Sie geht voran, um den Gästen ein Erholungsparadies zu schaffen. Der Ehemann wird zu Gunsten des Wohlbefindens der Gäste vernachlässigt, die Kinder müssen ihre Zimmer an kleine Fremde abtreten und werden in Spitzboden und Abstellkammern ausquartiert. Sie müssen »parat stehen«, um Wünsche der Gäste zu erfüllen oder »mal in der alten Tracht ein Lied zu singen oder ein paar Verse in der Inselsprache aufzusagen«.
Kein Wunder, dass der Zirkus den Kindern zuwider ist. Ryckmer verabscheut den »säuseligen Ton« der Mutter, wenn sie »gästisch« spricht. Tochter Eske fühlt sich »vorgeführt wie ein dressiertes Inseltier«, die gesamte bezahlte Gastfreundschaft mit rührseligem Abschiednehmen ist ihr unerträglich. Ihr Urteil steht fest: Die Mutter habe Mann und Kinder »weggeekelt«, sie trage die Hauptschuld am Zerfall. Für den kleinen Henrik, ein spätes »Wunschkind«, bleibt keine Zeit. Der kleine Unruhegeist läuft so nebenbei mit (»im toten Winkel großgeworden«). Heute sehnt sich Hanne, die ihn so lange übersehen hat, nach seiner Umarmung – als Vergewisserung, dass »ihr vergeben worden ist«.
Henrik musste erst einige Irrwege durchlaufen, bis er als Dreißigjähriger endlich sein Glück fand. Täglich wandert er mit seinem Hund den Strand entlang und sammelt auf, was ihm gefällt. Die Fremden haben aus den wundersamen Gebilden einen Hype kreiert und ihn zum »Treibgutkünstler aus dem Kutterschuppen« stilisiert, und seine »Driftwood Art« (von Kunstsachverständigen zur »Arte povera der Nordsee« geadelt) wird ihm aus den Händen gerissen. Der Rubel rollt, aber wohl fühlt sich Henrik selber nicht so recht.
Ehemann Jens Sander hatte sich als erster von der Familie abgesetzt und in ein schwankendes Pfahlhaus draußen auf dem »Driftland« zurückgezogen. In der Einsamkeit ist der Mann zum unberechenbaren, eigenbrötlerischen »Tattergreis« geworden. Er redet mit den Vögeln, aber seine drei Kinder, die einmal »irgendwie aus ihm herausgewachsen sind, wie wilde Triebe eines Baumes«, sind ihm fremd geblieben.
Ab und zu legt ein Versorgungsschiff an und wirft Lebensmittel, gelegentlich auch Wissenschaftler, Tierzähler oder Landvermesser an Land. Wenn sich aber Touristen den Sandbänken nähern, wird er aggressiv und vertreibt sie. Auch Jens, der »König ohne Land«, wird nicht verhindern können, dass das Umweltamt eines Tages seine »Prinzen « schickt und er abdanken muss.
Mit feinem Gespür beobachtet Hanne, wie sich die Insel, ihre Bewohner und ihre Besucher mit den Jahren verändert haben. Die Touristen haben jeden Anstand abgelegt und nehmen sich jede Freiheit heraus. Vor dem außergewöhnlichen Sander-Haus gaffen sie hinein, manch ein Makler mit Kalkül im Blick, denn der Immobilienhype lockt reiche Städter auf die Insel. Die Fremden benehmen sich wie Eroberer statt wie Gäste, und so bringt man ihnen auch kein herzliches Willkommen mehr entgegen: »Die Gesetze der Gekränkten gelten wohl auf allen Inseln: nie zu freundlich zu Touristen sein. Nicht lächeln. Nicht mit ihnen plaudern. Ihre Fragen höchstens einsilbig beantworten. Weil man die Hand, die einen füttert, nicht noch küssen muss.« Auch die cleveren Gewinner brauchen die Kundschaft nicht zu verzärteln. Die Familie Brix, die das Monopol auf Pferdekutschen hält, quetscht ihre Gäste doppelt aus. Die greifen, wenn es mal wieder regnet, dankbar zu den im Shop feilgebotenen Capes, die aussehen »wie die Kutten eines nassen Bettelordens, Ornate ihrer Selbstkasteiung«.
Natürlich gibt es kein Zurück in die Blütezeit, aber Stolz und Markenpflege gebieten es, die Tradition hochzuhalten. Wenn Hanne die Fremden durch das Inselmuseum führt, trägt sie selbstverständlich die aufwändige Tracht mit »bestickter Schürze … Perlenhaube … Brustschmuck aus verziertem Silber «. Imposant »wie ein dekorierter General« präsentiert sie darin auch sich selbst, die Kapitänsfrau »im Gewand der Tüchtigen«. Dann erzählt sie von Heldentaten, verherrlicht die »Walfangzeiten« – für Tochter Eske »nichts als Mythen und Folklore für die Gäste«.
Die Touristen ernten bissigen Spott und weise Kommentare der Autorin: »Alle Inseln ziehen Menschen an, die Wunden haben, Ausschläge auf Haut und Seele. Die nicht mehr richtig atmen können oder nicht mehr glauben, die verlassen wurden oder jemanden verlassen haben. Und die See soll es dann richten, und der Wind soll pusten, bis es nicht mehr wehtut.« Trotz mancher Ironie und humorvollen Passagen klingt als Grundton Desillusion durch: »Manchmal, nicht sehr oft, verschwinden Schiffe auf den Meeren, und sie werden nie gefunden.«
Dieses Buch habe ich in die Liste meiner 20 Lieblingsbücher im Herbst 2022 aufgenommen.
 · Herkunft:
· Herkunft: