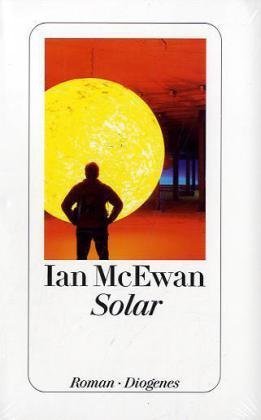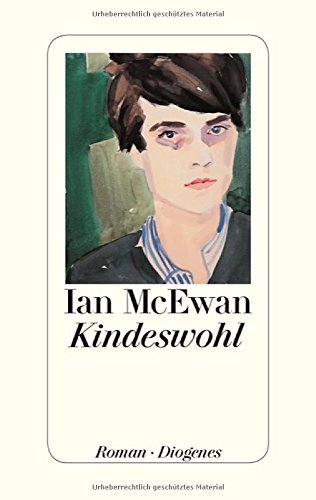
Eine Frage des Prinzips
Fiona Maye, 59, hat's nicht leicht, aber weit gebracht. Sie ist Richterin am High Court of Justice, Großbritanniens höchstem Zivilgericht, und zwar in dessen Family Division, der Kammer für Familienrecht. Ihre Kollegen schätzen ihre Kompetenz und bewundern den schnörkellos klaren, knappen Duktus ihrer Verhandlungsführung. »Göttliche Distanz, teuflische Klugheit, und dabei immer schön« – so charakterisierte sie der Lordoberrichter neulich beim Lunch.
Ihre Ehe mit Jack, einem Professor für Alte Geschichte, ist eine gut eingespielte, vertrauensvolle Routine. Für seine 61 Jahre sieht Jack »auf eine widerborstige Art« noch immer attraktiv aus. Aber für Kinder gab es in 35 Ehejahren wohl nie den richtigen Zeitpunkt.
Aktuell feilt Fiona an den abschließenden Formulierungen zu einem Scheidungsfall. Im Ringen um »unanfechtbare Definitionen«, die einst als Präzedenzfälle zitiert werden könnten, ist ihr bewusst, dass sie über die Jahre pedantischer und systematischer geworden ist. Jetzt muss sie über den weiteren Erziehungsweg zweier minderjähriger Schülerinnen entscheiden. Ihr Vater, ein ultraorthodoxer Charedim-Jude, hält gemäß der Ansichten seiner Glaubensgemeinschaft jegliche Ausbildung für unnötig. Doch die betreuende Sozialarbeiterin möchte die Mädchen auf der Gemeinschaftsschule belassen, bis sie volljährig sind und eigenverantwortlich über ihre weitere Entwicklung befinden können. Fiona muss wie immer Begriffe klären und Grundsätze gegeneinander abwägen. Die Aufgabe des weltlichen Gerichts ist nicht, »religiöse Konflikte oder theologische Differenzen zu entscheiden«, sehr wohl aber, Respekt gegenüber den Vorstellungen und Traditionen der Menschen zu wahren. Am Ende muss es möglicherweise im »Interesse des Kindes eingreifen« – also ein Prinzip zugunsten eines anderen zurücksetzen.
Der Leitgedanke für Fionas Wirken ist im ersten Abschnitt des Children Act von 1989 formuliert: »In jeder Frage der Sorge für die Person eines Kindes ... hat das Wohl des Kindes dem Gericht als oberste Richtschnur zu dienen«. Diesen Satz hat Ian McEwan auch seinem neuesten Roman »The Children Act«  vorangestellt (Werner Schmitz hat ihn übersetzt). Das passt, denn das Buch breitet in erster Linie eine Reihe von Aktenfällen aus, die wegen ihrer Brisanz (Grundsatzkonflikte in einer pluralistischen Gesellschaft) mediales Aufsehen erregt haben. Der britische Erfolgsautor hat sie lediglich ein wenig fiktionalisiert. Jeder einzelne Fall würde, wenn man sich tiefer in die menschlichen Schicksale und die moralischen, ethischen, religiösen und juristischen Fragen einließe, hinreichend Stoff für einen Roman mit klassischem Tragikpotenzial liefern.
vorangestellt (Werner Schmitz hat ihn übersetzt). Das passt, denn das Buch breitet in erster Linie eine Reihe von Aktenfällen aus, die wegen ihrer Brisanz (Grundsatzkonflikte in einer pluralistischen Gesellschaft) mediales Aufsehen erregt haben. Der britische Erfolgsautor hat sie lediglich ein wenig fiktionalisiert. Jeder einzelne Fall würde, wenn man sich tiefer in die menschlichen Schicksale und die moralischen, ethischen, religiösen und juristischen Fragen einließe, hinreichend Stoff für einen Roman mit klassischem Tragikpotenzial liefern.
Aber Dramatisieren ist nicht McEwans Anliegen. Vielmehr geht er vor wie seine auf hohem Niveau routinierte, intellektuelle Protagonistin: In nüchterner Sprache hakt er alle zu berücksichtigenden Aspekte ab, verdichtet bis zum name-dropping – »(Adam Smith, John Stuart Mill)« –, um am Ende in den Hafen eines überzeugenden Urteilsspruchs einzulaufen. Mancher Leser mag so eine distanzierte, kompakte Aufbereitung für oberflächlich halten, eine differenziertere Erörterung, mehr Konflikt, mehr Dramatik, mehr Empathie erwarten. Doch bei Entscheidungen wie den hier erzählten, die dem höchsten britischen Gerichtshof vorlagen, geht es schließlich ums Prinzip, nicht um Herzblut.
Ein siamesisches Zwillingspaar ist vom Becken bis zum Hals zusammengewachsen. Nur einer der beiden Jungen verfügt über die lebensnotwendigen Organe, und die versorgen den anderen mit. Der vollständigere Körper wird durch die permanente Doppelbelastung ausgezehrt; sechs Monate wird er noch durchhalten, schätzen die Mediziner, ehe er stirbt und dann auch seinem Bruder alle Lebensgrundlagen entzieht. Die Ärzte haben beantragt, das Paar operativ zu trennen, damit einer der Jungen überleben kann. Doch die Eltern, fromme Katholiken aus Jamaika, verweigern die Zustimmung. »Das Leben kam von Gott, und nur Gott durfte es nehmen.« Wie ist für jeden der Jungen »Kindeswohl« zu definieren? Sollen die Mediziner, um ein Kind zu retten, das andere töten dürfen? Hat das Kind ohne lebensfähigen Körper Interessen, die höher zu gewichten sind als die des Bruders? Geht es hier um »Nichtfortführung der Behandlung«, vorsätzlichen Mord oder unterlassene Hilfeleistung? In jedem Konfliktfall steht Fiona am Ende der Entscheidungskette und muss sorgsam abwägen. Darf sie den tiefschürfenden Fragen von Werteordnungen, Moralsystemen, Religionen pragmatische Lösungen entgegensetzen?
Auch im zentralen Fall muss die Richterin »Kindeswohl« zwischen den wichtigsten Konfliktpolen unserer Zeit definieren: Es geht um die Grundrechte des Individuums, Freiheit, Religion, die Rolle des Staates. Adam Henry, fast volljährig, ist an Leukämie erkrankt. Die Ärzte wünschen eine lebenserhaltende Bluttransfusion. Aber sowohl die Eltern als auch der junge Mann selber lehnen sie entschieden ab, denn nach ihrem Glauben (sie sind Zeugen Jehovas) ist Blut »die Essenz des Menschlichen« und ebenso heilig wie die Seele und das Leben selbst. Jede Vermischung mit anderem Blut (menschlich oder tierisch) bedeutet Verunreinigung, und wer sie zulässt, »weist das wunderbare Geschenk des Schöpfers zurück«.
Fiona hört die Eltern und die Ärzte im Gericht an und will sich dann selber ein Bild von Intellekt und Reifegrad des jungen Mannes machen, der das Recht auf Selbstbestimmung und über sein eigenes Leben einfordert. Sie lernt in der Klinik einen zierlichen Mann kennen, von der Krankheit gezeichnet und von Apparaten umgeben, aber mit offenkundig starkem Willen und von großer Reife. Fiona führt ihm drastisch vor Augen, was auf dem Spiel steht: »Würde das Gott gefallen, wenn du am Ende blind oder verblödet bist?« Doch Adam akzeptiert den Tod für sich. Die Gerichtsbarkeit, so hält er Fiona vor, mische sich in Dinge ein, »die sie nichts angehen«. Was ihn bewegt, hat er in ein Gedicht gefasst, das er Fiona vorträgt, und auch seine Begeisterung für das Geigespiel beeindruckt sie. Sie kennt den Text zu der melancholischen irischen Weise und stimmt voller Inbrunst ein: »Doch ich war jung und töricht und weine nun seither«.
Nach umfassender Würdigung aller Positionen entscheidet die Richterin, dass der junge Mann die Bluttransfusion auch ohne seine Zustimmung und die seiner Eltern erhalten soll: »Nach meiner Überzeugung ist sein Leben wertvoller als seine Würde.«
Adam lebt also weiter und gesundet. Zunächst können er und seine Eltern mit dem Urteil leben, denn sie tragen ja nicht die Verantwortung für die sündige Blutvermischung; »Schuld hat die Richterin, Schuld hat das gottlose System«. Aber dann verliert Adam den Boden unter den Füßen. Um Orientierung im Widerstreit der Werte zu finden, sucht er Hilfe bei der Frau, die ihm dieses Leben geschenkt hat, will gar bei ihr einziehen. Damit holt die lange ignorierte menschliche Dimension ihres juristischen Handelns sie mit Macht ein – und überrumpelt sie. Zwar weist Fiona Adams Ansinnen zurück, doch bei einer entscheidenden Begegnung kommt es in einem Augenblick unverzeihlicher Schwäche – die sich Fiona nie vergeben wird – zu einem keuschen Kuss. Was Adam bald als Judas-Kuss interpretiert, wird fatale Folgen zeitigen. Er wird an seiner neuen Freiheit scheitern.
Adams äußerst sensible Annäherung an die vier Jahrzehnte ältere Fiona findet eine Art Gegenstück in der plumpen Affäre, die Jack zur gleichen Zeit vorantreibt. Er wünscht sich eine Affäre mit Melanie (nicht einmal halb so alt wie er). »Ich brauche das«, gesteht er Fiona, und er meint damit ganz platt »ein Sexleben«. Wider Erwarten genehmigt ihm Fiona das Abenteuer nicht, sondern setzt ihn vor die Tür. Als sich die reine Körperlichkeit dann doch nicht als Erfüllung erweist, kehrt Jack zurück – und wird zum Seelentröster seiner von Schuldgefühlen geplagten Ehefrau.
Lesens- und nachdenkenswert fand ich McEwans neuen Roman allemal, so richtig gut aber nicht. Zwischen der Kopflastigkeit der Fallbehandlungen, der betonten Abgeklärtheit des Intellektuellen-Ehealltags und manchen Herzschmerz-Anfällen klaffen schwer überbrückbare Abgründe, aus denen das Prinzipielle der Konstruktion allzu deutlich emporschimmert. Ein richtiger Plot fehlt. Und auch am High Court of Justice kommt man nicht ohne Klischees und Trivialitäten über die Runden.
 · Herkunft:
· Herkunft: