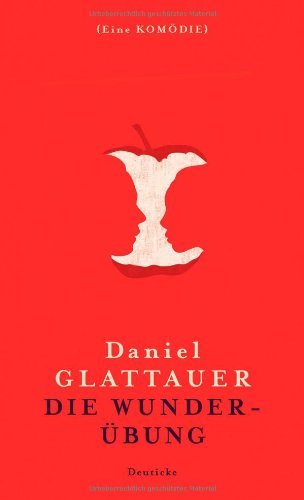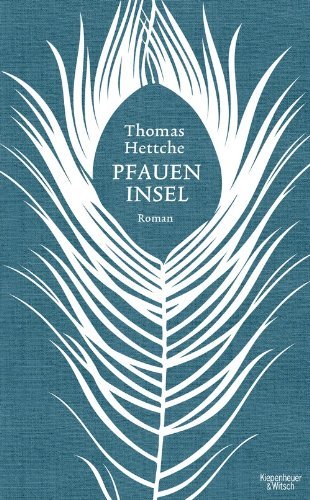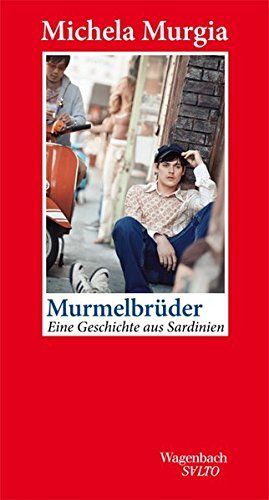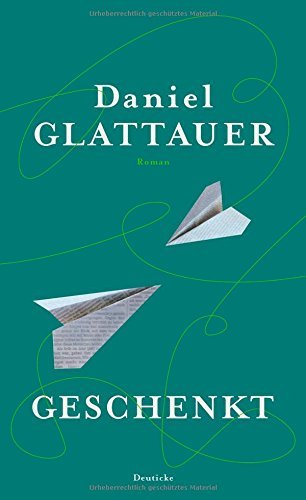
Der Che Guevara aus Simmering
Wenn in Wien, meiden Sie besser die urdeutschen Wörter »Kumpels« und »Kneipen«. »Haberer« und »Beisln« sind die korrekten indigenen Bezeichnungen. Gerold »Geri« Plassek, 43 und aus dem urwienerischen Arbeiterviertel Simmering gebürtig, weiß das natürlich. Schließlich trifft er sich allabendlich mit seinen Freunden beispielsweise in »Zoltan's Bar« (Schlachthausgasse). Indem er in seiner Erzählung trotzdem die verachteten »K«-Importe verwendet, distanziert er sich selbst ein wenig von seinen Umtrieben (sagt er). Denn er muss einräumen, dass man da bloß in immer gleicher Runde »völlig uninspiriert« beisammensteht, profund über die Gemeinheiten debattiert, die das eigene Leben einem bereitet, aktuelle sowie längst vergangene Beziehungen durchkaut und die harte Wirklichkeit mit reichlich Alkohol wegspült, bis Zoltan, der schweigsame Ungar, die letzte Runde einläutet. Dann ist Mitternacht schon lange vorüber.
Geri ist ein licht- und arbeitsscheues Wesen, das sich genügsam durchs Leben schlägt. Sein Habitat ist ein »Miniloft für Minderprivilegierte«, de facto ein »Wohnküchen-Büro-Schlafzimmer«. Hier schläft er seinen Rausch aus, erholt sich bis zum Mittag von den anstrengenden Nachtstunden und stellt sich dann zu verträglicher Zeit in immergleichen Lotterlook-Klamotten der Menschheit und den Herausforderungen des Lebens.
Seinen bescheidenen Lebensunterhalt verdient Geri bei der Wiener Gratistageszeitung »Tag für Tag«, ein werbefinanziertes, »weitgehend kulturloses Blatt für ein weitgehend kulturloses Publikum«, wo er die Leserbriefspalte betreut, eine Abteilung von peripherer Bedeutung im peripheren Ressort »Soziales«. Die Tage vergehen unspektakulär und gleichförmig. Spaß macht die Arbeit nicht, aber immerhin macht sie keine Arbeit.
Vor gut fünfzehn Jahren hatte Geri noch Perspektiven, eine Zukunft als Journalist bei der bedeutenden »Rundschau« und jede Menge Frauen. Eine davon, Gudrun, wurde seine erste und einzige Ehefrau, doch sie schickte »das Riesenarschloch« schnell wieder in die Wüste. Am Tag nach der Scheidung wurde die gemeinsame Tochter Florentina geboren.
Gudrun heiratete dann den vermögenden Berthold Hille, »Lobbyist in der Schwerindustrie ..., genauer will man es nicht wissen, außer man ist Staatsanwalt«. Obwohl sich das »Industriellenherz« rührend um Florentina kümmert, schlägt ihr pubertäres Herz für ihren leiblichen Vater Geri. Ein »konsum-desorientierter, unrasierter, schlampig gekleideter, dezent versoffener Kerl ..., der es sich scheinbar leisten konnte, nichts zu leisten«, hat es leicht, bei einer Fünfzehnjährigen Kultstatus einzunehmen.
Da die Bilanz der Versäumnisse während der Kurzehe einigermaßen ausgeglichen war, pflegen die Geschiedenen noch regelmäßig Kontakt miteinander. Freilich nimmt Geri die monatliche Einladung zum Abendessen am liebsten an, wenn der »Monarch« nicht anwesend und Geri nicht als »eine Art Minnesänger« auftreten muss.
Im Frühsommer hat Geri ein weiterer Brückenschlag aus seiner liebestollen Vergangenheit erreicht. Nach fünfzehn Jahren hat Alice sich bei ihm gemeldet. Sie möchte ihn treffen, habe etwas mit ihm zu besprechen. Will sie vielleicht (bildet Geri sich ein) die alte Liebe reanimieren?
Mitnichten. Alice braucht nur eine Anlaufstelle für Manuel. Der Knabe entsprang einem gemeinsam verbrachten Wochenende, das ansonsten folgenlos blieb. Alice, inzwischen Ärztin, soll für ein halbes Jahr nach Somalia; ihre Schwester Julia wird sich des Buben annehmen, aber nicht nachmittags, wenn sie arbeiten muss. Auf diese Weise erfährt Geri, dass er auch der Erzeuger eines Sohnes ist und jetzt ein paar Stunden Verantwortung für ihn übernehmen soll. Manuel sei ein prächtiger Musterknabe mit guten Noten und vielen Freunden.
Nun sitzt der Vierzehnjährige in Geris »Büroraum« (wobei sowohl »Büro« als auch »Raum« Euphemismen sind) und tut so, als erledige er wichtige Hausaufgaben. Den ungepflegten, uncoolen Typ, den seine Mutter ihm als »guten Freund aus alten Tagen« angepriesen hatte, kann er nicht ausstehen.
Damit ist das persönliche Profil des Protagonisten von Daniel Glattauers neuem Roman hinreichend umrissen. Die eigentliche Handlung aber orientiert sich an einer wahren Begebenheit, dem »Wunder von Braunschweig«. Ab November 2011 trudelten bei sozialen und karitativen Einrichtungen und unverschuldet in Not geratenen Einzelpersonen der Gegend anonyme Bargeld-Spenden ein, jeweils zwanzig 500-Euro-Scheine im weißen Briefumschlag mit aktuellen Ausschnitten aus der Braunschweiger Zeitung. Bis Januar 2014 wurden so über 260.000 Euro verteilt. Ob dahinter eine Einzelperson oder eine neue Spendenkultur steckt, ist unbekannt.
Glattauer verlegt die Aktion nach Wien. Die Zeitungsartikel sind »Tag für Tag« entnommen und stammen aus Gerold Plasseks Feder. Plötzlich geht es aufwärts mit dem Schreiberling: »Ein in die Jahre gekommener, gesettelter Langweiler mit geregelten Hopfen-und-Malz-Zeiten« wird im Laufe der Handlung zum Gewinner.
Als erstes wirft er bei seinem rechtskonservativen Anzeigenblättchen die Brocken hin, und bald nimmt ihn die Tageszeitung »Neuzeit« – der Name ist Programm – als gut bezahltes Zugpferd unter ihre Fittiche. Gerold Plassek, in allen Wiener Medien gerühmt, wird zum »Volkshelden«. Seine Stütze ist Manuel, der recherchiert, die Einrichtungen besucht und Interviews führt, so dass Geri nur »für eine sinnvolle Aneinanderreihung deutscher Sätze« zu sorgen braucht. Mit jeder weiteren Spende entwickeln sich aus der anfangs gespannten Beziehung »Sternstunden« voller gemeinsam genossener Euphorie. Doch merkwürdigerweise durchschaut der clevere Manuel bis zum Schluss nicht, dass Geri mehr ist als einer von Mamas Verflossenen.
Das Leben könnte einem Autor kaum schönere Geschichten als Steilvorlage servieren. Aber Glattauer macht daraus eine allzu schmerzfreie Soft-Komödie mit Happy End und allzu trivialen Typen, die amüsieren, aber nicht überzeugen.
Selbst der Protagonist ist inkonsequent konzipiert. Verdient er Sympathie oder Mitleid? Geri verhehlt nicht, dass er keinen Grund hat, auf seine wüste Vergangenheit, seine versiebte Journalistenkarriere, seinen Lebenswandel als dauerbenebelter Alk oder seinen Faulpelz-Schmarotzer-Charakter stolz zu sein. Doch er präsentiert sich im typischen jovialen Kneipenton, der augenzwinkernd alles ganz lustig und halb so schlimm erscheinen lässt. Andererseits formuliert er (bzw. Glattauer in seinem Namen) tatsächlich ganz witzig, stellenweise geistreich. Ist er ein verkapptes Genie, zur Selbstironie fähig? Doch dann fällt ihm – einem wortgewandten Medien-Profi! – zum Stichwort »Autismus« nichts ein, und von Dustin Hoffmans »Rain Man« hat er nur eine vage Ahnung. Das passt alles nicht recht zusammen.
Lernfähig scheint Geri auch nicht. Seine Einstellung zu Frauen war und bleibt dumpfbackig. Eine Zahnärztin, perfekt und unnahbar, baggert er derart plump und weltfremd an, dass es schon Zahnschmerzen bereitet ...
Manuel ist vom Typ Musterschüler in gebremster pubertärer Aufmüpfigkeit gegen den Vater, Florentina das weibliche Gegenstück, die sanfte Revoluzzerin in »Armani-Diesel-Ausstattung«. Natürlich fährt sie auf den drogensüchtigen Bassisten einer Psychedelic-Rockband ab. Wirtschaftmanager Berthold Hille hinterzieht natürlich skrupellos Steuern und parkt Geld in Liechtenstein. Und Gutmensch Alice leistet selbstlos Hilfe in Somalia ...
Daniel Glattauer kann aus dem Nähkästchen des Feuilletons plaudern, wo er ja selber jahrelang tätig war. Doch nicht einmal seine Seitenhiebchen auf die Kommerzialisierung der Medien hinterlassen Kerben. Sein Sprachwitz tröstet über viele Schwachstellen hinweg. »Geschenkt« ist ein Wohlfühlbuch, das auf sehr leichte, entspannende Weise unterhält – eine warme Plüschdecke aus Kunstfaser, nicht mehr und nicht weniger.
 · Herkunft:
· Herkunft: