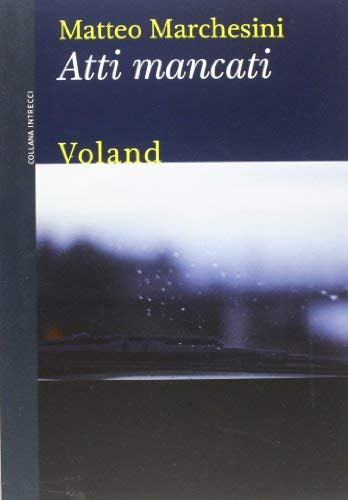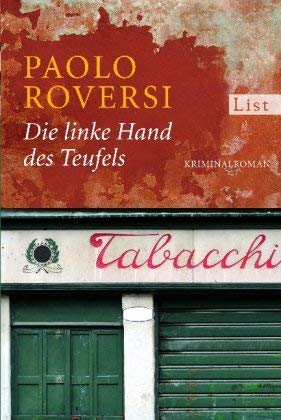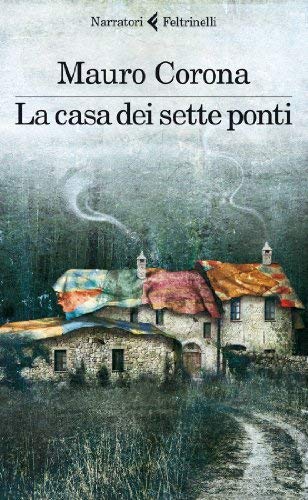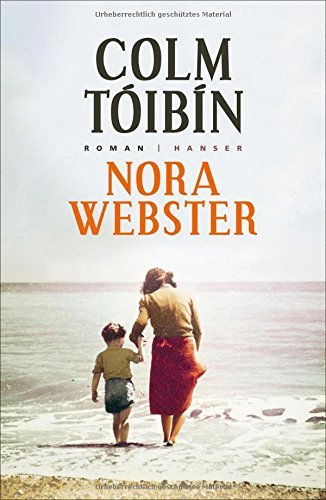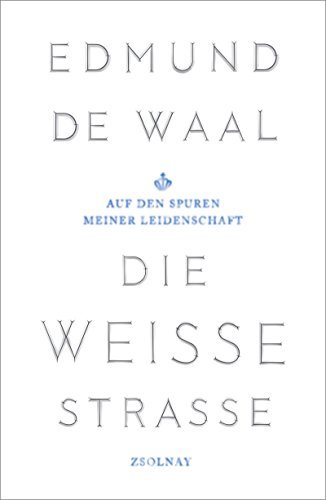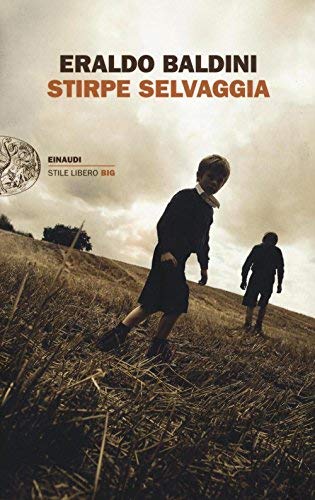
Das wilde Leben im Wald - Segen und Fluch
Eraldo Baldini hat ein Genre erfunden. Nachdem sich der heimatverbundene Mann, 1952 bei Ravenna geboren, schon immer für die volkstümlichen Traditionen seiner ländlichen Region begeistert und wissenschaftliche Aufsätze darüber verfasst hatte, begann er in den Neunzigerjahren, auch Geschichten und Romane mit dieser Thematik zu schreiben. Mit »Gotico rurale«  , einer Sammlung von Erzählungen, gelang ihm im Jahr 2000 der Durchbruch, und fortan diente der Titel dieses Kultbuches auch gleich als Genrebezeichnung für andere Werke dieser Spielart. Sie verbindet realistische Krimi- oder Abenteuer-Plots mit unaufdringlich eingesetzten, teils relativierten (»almeno a sentir lei«) Elementen aus lokalen Mythen, Sagen und Märchen sowie einer Spur Horror und Fantasy. Damit transponiert Baldini gewissermaßen eine rational gut verträgliche Form der Gothic novel aus den nebelverhangenen britischen Moorlandschaften ins Land, wo die Zitronen blühen.
, einer Sammlung von Erzählungen, gelang ihm im Jahr 2000 der Durchbruch, und fortan diente der Titel dieses Kultbuches auch gleich als Genrebezeichnung für andere Werke dieser Spielart. Sie verbindet realistische Krimi- oder Abenteuer-Plots mit unaufdringlich eingesetzten, teils relativierten (»almeno a sentir lei«) Elementen aus lokalen Mythen, Sagen und Märchen sowie einer Spur Horror und Fantasy. Damit transponiert Baldini gewissermaßen eine rational gut verträgliche Form der Gothic novel aus den nebelverhangenen britischen Moorlandschaften ins Land, wo die Zitronen blühen.
Baldinis neuester Roman »Stirpe selvaggia«, am 29. November 2016 erschienen, spielt in den ersten vier Jahrzehnten des zwanzigsten Jahrhunderts in der düsteren, rauen, gebirgigen und waldreichen Appenin-Region der Romagna, wo sie im Süden an die Toskana grenzt. Der Autor zeichnet vorwiegend Bilder vom harten, urtümlichen und grausamen Leben, das die armen, einfachen und erdverbundenen Menschen dort führten. Die Städte in der Po-Ebene – Faenza, Ravenna – spielen nur zeitweise eine Rolle, als ferne Orte des Handels, der Bildung, des Militärs, der Politik und der Kirche; das Meer kann man nur unter günstigsten Bedingungen als Streifen in der Ferne ausmachen – aus eigener Anschauung kennt es niemand.
Im (fiktiven) Bergdorf San Sebastiano in Alpe wachsen Amerigo Timossi, Mariano Sintini und Rachele Ceroni, etwa gleichaltrig, als unzertrennliche Freunde auf. In der Tat wird ihre Verbindung ihr Leben lang halten, so weit ihre Wege auch auseinanderlaufen. Die drei Kinder haben höchst unterschiedliche Hintergründe. Einzig Mariano stammt aus einer ›gutbürgerlichen‹ Familie im traditionellen Sinne; seine Eltern betreiben ein Geschäft für Saatgut und Geräte und haben ihrem Sohn Bildungs- und Aufstiegswillen vermittelt. Amerigo, die zentrale Figur des ganzen Romans, wurde, wie schon seine Mutter Giulia, von deren urigem Vater Luigi großgezogen. Er prägte den Jungen für ein völlig ungebundenes und weltabgewandtes Leben in der freien Natur, wo ihm bald schon nichts fremd ist, seien es Gefahren, Schönheit oder Brutalität. »Il coltello è un buon fratello«, lautet einer der Leitsätze, die Amerigos Wesen beeinflussen werden.
Ein zweiter Umstand, der Amerigos Lebenslauf bestimmt, ist die Persönlichkeit seines Vaters. Das ist kein Geringerer als William Frederick Cody, bekannt als Buffalo Bill. Wie in aller Welt das möglich ist, erzählt uns der Autor durch und durch plausibel in einem der Seitenstränge. Als junges Mädchen wurde die anstellige Giulia von der Contessa Elisabetta Fulvia Barnini, einer Opernsängerin, in Dienst genommen – ein Segen und ein Fluch zugleich. Bei ihr lernt Giulia die feine Lebensart kennen, doch erwächst daraus auch eine Feindschaft auf Leben und Tod. Zunächst aber darf Giulia die Diva auf einer ausgiebigen Tournee durch die USA begleiten und gerät bei einer Promi-Party in die Fänge des Wild-West-Helden. Als unverheiratete Mutter kehrt die Achtzehnjährige mit ihrem Neugeborenen zu ihrem Großvater nach San Sebastiano zurück.
Racheles Mutter Alma ist eine starke Persönlichkeit mit offenen Sinnen für alles, was Naturglaube, bäuerliche Erfahrungen und Erzählungen überliefert haben. Schon als Kind hat sie es geschafft, den Mazzapegolo, ein mal bösartiges, mal gutwilliges kleines Gnomwesen mit rotem Wollmützchen, für ihre Dienste einzuspannen. Mit ihrem uralten Wissen, ihren Heilkräften und guten Kontakten zu »l'altra gente«, großen und kleinen Märchen- und Zauberwesen aller Art, ist sie als Hebamme und Medizinfrau des Dorfes – eine Art gute Hexe – so geschätzt wie rätselhaft: »Una benedizione e una maledizione insieme«. Die Zerreiche, die sie vor ihrem Häuschen pflanzt, wird zu einem Leitsymbol für das Wohlergehen der ganzen Gemeinschaft, und ihr altersloser Hund Belva wird auch noch ihre Tochter Rachele durchs Leben begleiten (»angelo custode e nume tutelare che sapeva sempre cosa fare, perché il suo sapere non era quello di un cane, ma quello enorme del mondo«).
Auf diesem Grundgerüst entwickelt Eraldo Baldini ein weit verzweigtes, in sich schlüssig konstruiertes, abenteuerreiches Handlungsgeflecht, das eng mit den politischen, wirtschaftlichen und sozialen Veränderungen jener Jahre verwoben wird. Dreh- und Angelpunkt bleibt stets die bäuerliche Kultur der Berge, aber wir lesen auch, wie sich die Protagonisten mit den Carabinieri des Königs, in den unmenschlichen Schlachten des Ersten Weltkriegs und im Faschismus schlagen. Die Erzählstruktur ist im Wesentlichen schlicht chronologisch, nur die Vorgeschichten einiger wichtiger Figuren werden in separaten Kapiteln eingebettet.
Der Autor – bei uns noch völlig unbekannt – schreibt mit sehr sicherem Gefühl für präzisen, differenzierten, ästhetischen Stil, erzählt ohne Mätzchen warmherzig und mit viel Verständnis für seine Figuren (die oft genug fragwürdige Entscheidungen treffen), und es gelingt ihm, neben den vielen Abenteuern stets ein intensives Zeit- und Lokalkolorit und eine dichte Naturatmosphäre aufrechtzuerhalten.
Wer ein spannendes, kurzweiliges, rundum unterhaltsames Buch sucht, kann hier bedenkenlos zugreifen – auch wer mit dem Irrationalen ansonsten gar nichts am Hut hat.
 · Herkunft:
· Herkunft: