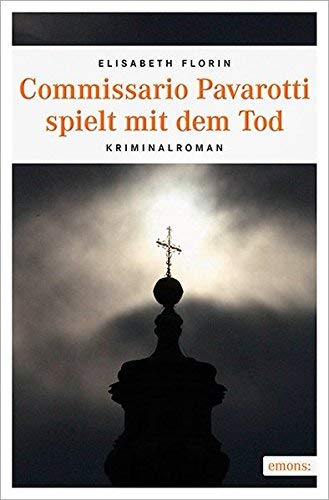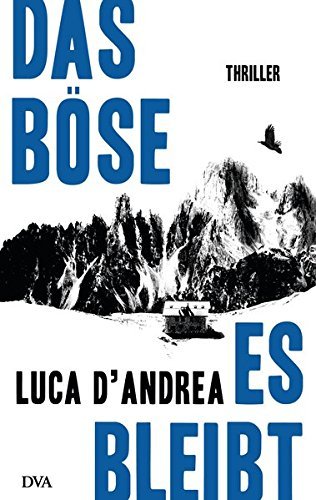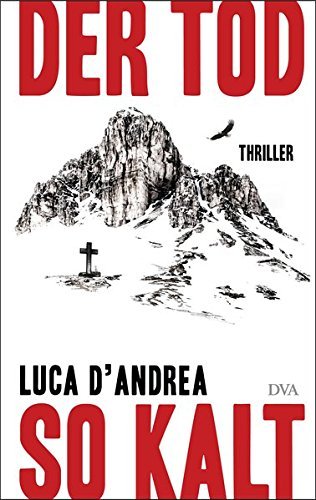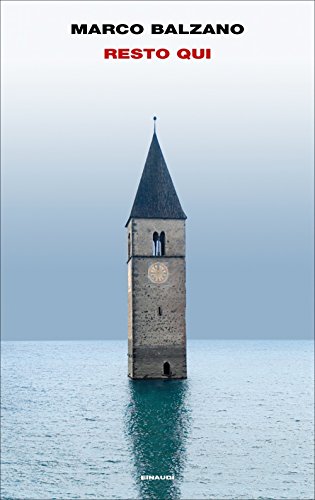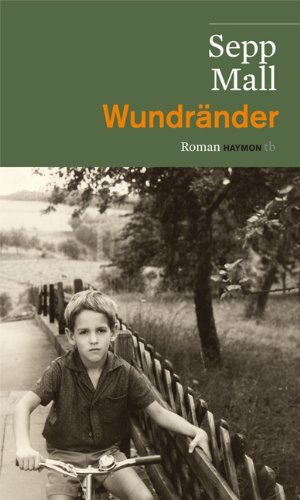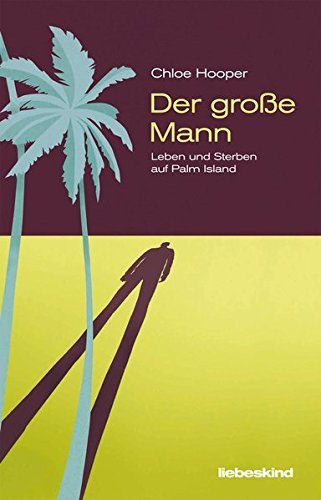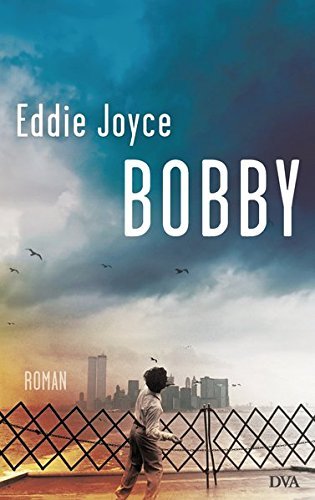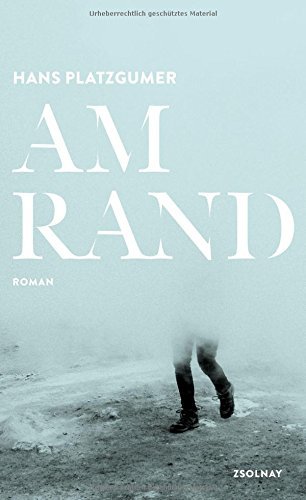
Was macht ein Nicht-Held auf dem Gipfel?
Der Tod ist Gerold Ebners treuester Begleiter. Sein kurzer Lebensweg – nur zweiundvierzig Jahre lang – ist arm an Segnungen und Freunden, aber an Leichen fehlt es nicht. Am Anfang steht (richtiger: sitzt) ein vereinsamter alter Nachbar, der erst nach einem Jahr unbemerkten Mumifizierens bei laufendem Fernseher endlich aufgefunden wird. Der kleine Gerold, dem der wunderliche Anblick nicht erspart werden kann, nimmt's gefasst: Ein aufgebrauchtes Leben, alles scheint entwichen. Schön und zufrieden sieht der Tote aus.
Als Teenager lernt er schon eher das Fürchten. Nach der Devise, ein Südtiroler kenne keine Höhenangst, kokettieren seine Kumpel bei ihren Spielen mit haarsträubenden Gefahren. Gerold muss wohl oder übel mitmachen, wenn sie auf nächtlichen Baustellen zur Spitze des Kranauslegers rennen oder sich mit schweißnassen Händen klammernd herabbaumeln lassen. Dass Sascha Jovanic von der Merano-Bande vom Pfeiler der Autobahnbrücke abstürzt: »selber schuld«, er war Jugoslawe. Jahre später verschmilzt Jugendfreund Peter augenblicklich und unlösbar mit einem Hochspannungskabel, das er versehentlich berührt hat.
Gerold verharrt aber nicht im Status eines staunenden Beobachters. Zwei Mal bringt er selbst den Tod, wo er ihn als Erlösung erkennt. Seine Mutter befreit er von den Heimsuchungen ihres Vaters, eines widerlichen Tyrannen, und Guido Senoner, einen anderen früheren Gefährten, auf dessen Wunsch aus seiner aussichtslosen Pflegebedürftigkeit, nachdem er versehentlich seine Speiseröhre verätzte.
Viele absonderliche und deprimierende Episoden wie die angedeuteten erzählt uns Gerold Ebner, und er beschreibt sie in allen, oft tief berührenden, auch schaurigen Details, garniert mit grausigen Spekulationen und makabren Überlegungen. Aber sein Ton ist durchweg unpathetisch, klaglos, nahezu emotionslos, wie der eines unbeteiligten Zeugen trister Schicksale, von denen eines, als erkenne er es nicht, sein eigenes ist.
Der Stil fließt ungekünstelt. Er ist bewusst gewählt und überzeugend gestaltet. Schließlich ist Gerold Ebner Schriftsteller, wenn auch ein erfolgloser. Keines seiner Romankonzepte hat er je vollendet. Er haderte mit Unvereinbarem, dem Konflikt zwischen Realität und Fiktion, zwischen Autobiografischem und der Distanzierung davon. Jetzt aber schreibt er einfach nur »mit Kugelschreiber auf Papier« sein Leben nieder, und dabei geht es ihm allein um Genauigkeit. Denn »präzise will ich jetzt sein, alles andere wäre Zeitverschwendung.«
Die Zeit wird nämlich knapp. Den Tag der Niederschrift (11. Oktober 2012) hat er zu seinem letzten bestimmt. Penibel vorbereitet, ist er am sehr frühen Morgen aufgebrochen und nach langem Aufstieg »angekommen«. Den Gipfel des Bocksbergs (»ein wenig beachteter Felsbrocken«) erhöht er zum Ziel seines Lebensweges. Hier findet er die Ruhe, um zu schreiben, bis am Abend das Tageslicht schwindet, die Batterie seiner Taschenlampe entleert den Schlusspunkt setzt. Dann wird er die vollgeschriebenen Blätter in eine Plastiktüte stecken, sie unter einen Felsen schieben und seinen letzten Schritt tun, vom Gipfel in den Abgrund springen.
Das Manuskript ist eine Art »Vermächtnis«, es soll von »einer oder einem Unbekannten« gefunden und gelesen werden, also von uns. Wiederholt wendet sich der Verfasser direkt und im Singularsinn an uns, nicht zuletzt, um uns nebenbei kleine praktische Gefälligkeiten aufzutragen (»Ich bitte Sie, schalten Sie das Lichtchen für mich ab.« »Geben Sie ihr meine Zeilen zu lesen.«). Vor allem kündigt er rückhaltlose Offenheit an: »Feigheit und Schwäche, alles werde ich mir heute zugestehen. Ich darf alles ... Der Fels ist jetzt mein Beichtstuhl und ich öffne mich Ihnen.« Erwartet er, dass wir ihm für seine Tötungen eine Art weltliche Absolution erteilen? Könnten wir das?
Einen Abschiedsbrief schreibt Gerold Ebner nicht. Es gibt keinen Adressaten mehr. Zu seiner lebenslangen Existenz »am Rand« passt, dass er alle, die ihm lieb waren, verloren hat. Seine Geschichte – »wie ich hierhergekommen bin« – beginnt auch randständig in Westösterreich, nicht in einer sonnigen Touristenidylle, sondern auf der glanzlosen, schattigen Nordseite der Alpen.
Schon Gerolds Mutter Maria war eine Ausgegrenzte. Als junges Mädchen setzte sie sich aus ihrem engen Vinschgauer Heimatdorf Glurns (»kleinste Stadt Südtirols«) ab und zog zu Verwandten in den Norden. Die wohnten als »Optanten« (deutschsprachige Südtiroler, die man im Faschismus vor die Wahl gestellt hatte, nach Hitler-Deutschland auszusiedeln oder im Mussolini-Tirol italianisiert zu werden) in der Siedlung, die die Nazis hier für sie angelegt hatten. Maria verkaufte sich als preisgünstige »Schillingfrau« an Freier, die aus der Schweiz über die Grenze kamen, bis sie schwanger wurde. Danach wandelte sie sich zu einer treu katholischen Büßerin und arbeitete aufopferungsvoll als Altenpflegerin ihre Schuld ab.
Die »Südtirolersiedlung«, wo Gerold weitgehend sich selbst überlassen aufwächst, ist ein von den Einheimischen gemiedener Ort. Jugendbanden von Zugewanderten (»Gesocks«) aus Anatolien und vom Balkan machen dem Nachwuchs der Optanten die Straßen streitig. Heimatlos, verachtet und perspektivlos sind sie alle gleichermaßen. Hier muss Gerold sich durchschlagen. Seine katholische Erziehung hilft ihm nicht, er findet nicht den »Glauben an Gott«. In der Schule wird er gehänselt, fertiggemacht. Zusammen mit seinem einzigen Freund Guido besucht er eine Shotokan-Karateschule. Der eiserne japanische Lehrer, der sich unnahbar von jeglichem Leben um ihn herum abschottet, prägt die Jungen tief. Er bläut ihnen ihre »individuelle Nichtigkeit« ein und dass seine Kunst darin bestehe, »das Kämpfen zu vermeiden«. Der Hass auf die feindlichen Banden aber spornt die beiden Buben an, das Kämpfen zu lernen, die absurdesten Mutproben zu überstehen. Damit ist Gerold auf die Härten des Lebens vorbereitet, kann ausführen, was es von ihm zu verlangen scheint. Ein wirklich Handelnder wird er jedoch nicht einmal, als er den Schritt vom passiven Zuschauer zum Mörder tut.
In beiden Fällen gehen ihm die Taten wie fremdbestimmt von der Hand. Zweifel, Skrupel kommen ihm nicht in die Quere. Die Umstände scheinen ihm keine Wahl zu lassen. Er hat keinerlei Vorteile, seine Täterschaft bleibt perfekt verborgen. »Friedlich im Schlaf gestorben«, so würde die Mutter bei ihrer Rückkehr den Großvater in seinem Totenbett auffinden. Und Guido bedrängt Gernot selbst, ihn von seinen unerträglichen Qualen zu erlösen. Im Wissen, »dass niemand sonst es tun kann«, kann er seinem Freund den Wunsch nicht verwehren. An uns, den Lesern seiner Lebensbeichte, liegt es, über seine Schuld zu urteilen.
Gernot Ebner nimmt sein Schicksal niemals in die Hand. Um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, übt er die unterschiedlichsten Tätigkeiten aus, aber die meisten sind banal, benötigen seine sprachliche Begabung nicht, fordern keine Kreativität. Mit Elena lernt er eines Tages eine Frau kennen, die ihm zumindest in gewisser Weise verwandt ist – sie schreibt Auftragstexte, lektoriert und dergleichen –, auch sie kommt nicht aus der Mitte der Gesellschaft, auch sie handelt recht eigenwilligen Vorstellungen folgend. Mit ihr und einem kleinen Mädchen kann Gernot eine kurze Spanne lediglich geliehenen Glücks genießen, ehe der Tod wieder ein grausames Spiel mit ihm treibt. Ein dummer Unfall, den er womöglich hätte verhindern können, wenn er beherzter hätte handeln können, nimmt ihm alles und treibt ihn letztendlich an den Rand des finalen Abgrunds auf dem Bocksberg.
Dies ist ein ganz auf eigene Weise fesselnder Roman, voll ungewöhnlicher, teils bizarrer Lebenssituationen und Gedanken und doch fest im Boden der komplexen Realität verankert. Sein Autor Hans Platzgumer, ein äußerst umtriebiger österreichischer Musiker, Schriftsteller und Produzent, spielt wie sein gleichaltriger Protagonist mit Fiktion und Perspektive. Er stellt ihm einen gleichnamigen Nachbarn zur Seite, spendiert ihm eine Etymologie seines Namens (Das Leben in Platzgumm im Vinschgau war so mühselig und hart, dass »die dort zu leben Verdammten Kummer mit dem Platz hatten«.), skizziert ihn als alternativen Helden. Denn Hansi Platzgummer – aus einer Familie, die schon seit Generationen in Österreich ansässig, aber nie heimisch geworden war – setzt sich nach Amerika ab, um sich von dem elenden Erbe, »dem Schatten, den die Berge seiner Vorfahren auf ihn warfen«, und der »Unzufriedenheit mit dem Platz, an dem er zu leben hatte«, endlich zu befreien. So viel freier Wille, so viel Tatkraft ist Gernot Ebner nicht gegeben. Er bleibt gefangen; sein »persönliches Platzgumm war Glurns ..., das Schattenloch.«
 · Herkunft:
· Herkunft:  · Region: Südtirol
· Region: Südtirol