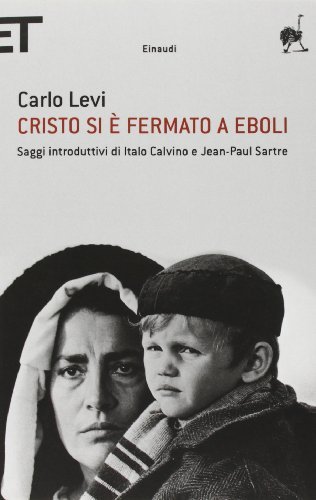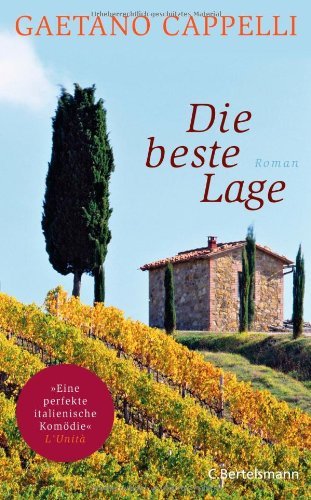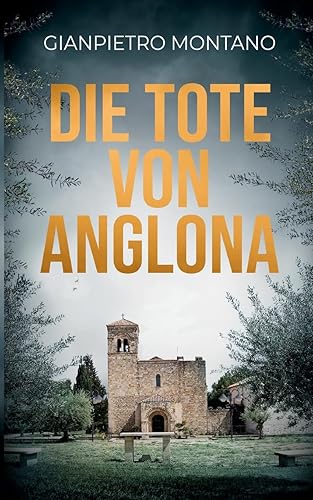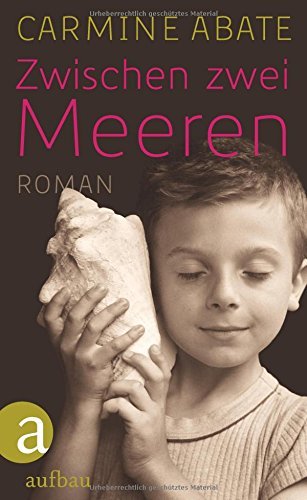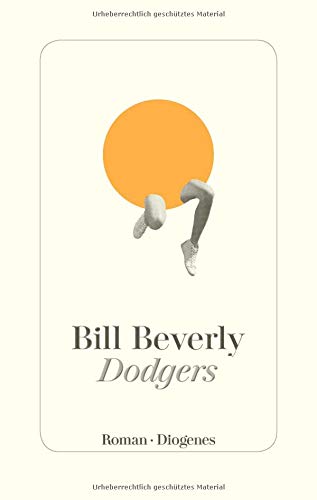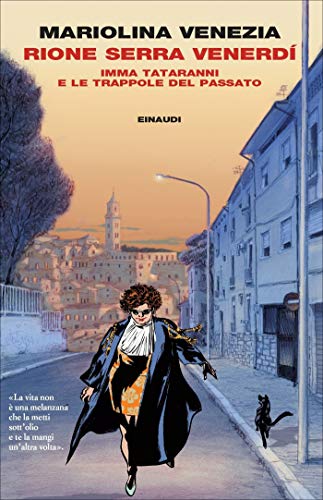
Rione Serra Venerdì
von Mariolina Venezia
Wer hat die unscheinbare Stella Pisicchio in Matera erwürgt? Und wo steckt der Gassenjunge Eustacchio aus der Wohnung drüber? Mindestens ebenso wichtig ist, was die Ermittlerin Imma Tataranni, eine Frau wie ein Vulkan, in ihrem Inneren antreibt.
Alte Freundschaften
Immacolata Tataranni ist »PM« (Pubblico Ministero) bei der Procura della Repubblica in Matera, also Staatsanwältin. Dass sie so eine staatstragende Funktion ausübt, sieht man ihr nicht an. Ihr greller Kleidungsstil beispielsweise ist ein Schlag gegen die Würde ihres Amtes, wenn nicht gegen den guten Geschmack, kompensiert aber ihre unauffällige Körpergröße und verstärkt wie ihre feuerrote Mähne die Wirkung ihres energischen Auftretens. Büroarbeiten sind, wie zu erwarten, nicht ihr Ding. Anders als ihre Kollegen, die hinter Respekt heischenden Schreibtischen residieren, ist sie lieber mittendrin, wenn es etwas zu ermitteln gibt, besucht die Tatorte, befragt die Zeugen, drängt den Rechtsmediziner zu ersten Vermutungen.
Imma ist eine Art menschlicher Vulkan. Sie ist willensstark bis störrisch, furchtlos (auch vor ›großen Tieren‹) bis widerspenstig, offenherzig bis brüsk, und sie macht sich nicht beliebter, wenn der Jähzorn sie packt, sie schrill durchs Büro kommandiert oder ihren Zynismus nicht zügelt. Wegen ihrer fachlichen Kompetenz erträgt man sie seufzend, aber mancher Mann findet sie attraktiv, unter anderen ihr liebevoller, geduldig ausgleichender Gatte Pietro. Dagegen sorgt die fünfzehnjährige Tochter Valentina mit ihren Experimenten zur Partnerwahl für zusätzlichen Stress. Freude hat Imma in der Küche, wo sie regionale Köstlichkeiten zaubert (insalata di arance e finocchi, peperoni fritti con le olive, ciambotta, lampascioni, soppressata, melanzane e carciofini).
Die bei uns noch weitgehend unbekannte Schriftstellerin Mariolina Venezia (1961 in Matera geboren) hat mit dieser Figur eine markante Persönlichkeit voller Widersprüche geschaffen und bereits den dritten Kriminalroman mit ihr veröffentlicht. Die beiden ersten Folgen, »Come piante tra i sassi«  (2009) und »Maltempo«
(2009) und »Maltempo«  (2013), werden zurzeit für das Fernsehen verfilmt (Ausstrahlung im Herbst 2019 auf RAI uno). Mit der Familiensaga »Mille anni che sto qui«
(2013), werden zurzeit für das Fernsehen verfilmt (Ausstrahlung im Herbst 2019 auf RAI uno). Mit der Familiensaga »Mille anni che sto qui«  (»Tausend Jahre, die ich hier bin«
(»Tausend Jahre, die ich hier bin«  ) gewann Mariolina Venezia 2007 den renommierten Premio Campiello.
) gewann Mariolina Venezia 2007 den renommierten Premio Campiello.
Jetzt hat Imma einen Mordfall aufzuklären, dessen Opfer ihr wohlbekannt ist. Stella Pisicchio war auf dem Gymnasium ihre Klassenkameradin – damals ein schüchternes Mädchen mit Zöpfen, das sich nicht um Jungs scherte. Inzwischen ist sie offenbar eine andere gworden, denn als man sie erwürgt in ihrem Bett auffand, war sie nicht nur spärlich bekleidet, sondern auch in aufreizender Weise nach SM-Gepflogenheiten zurechtgemacht.
Um dem Mörder auf die Spur zu kommen, frischt Imma ihre eigenen Erinnerungen auf (ihr unfehlbares Gedächtnis ist eine Geheimwaffe), besucht Stätten ihrer Jugend, befragt alte Bekannte in der Stadt und auf dem Lande, und ihre dienstlichen Ohren hören aufmerksam mit, wenn ihre früheren Mitschülerinnen loslegen. Das Klatsch-und-Tratsch-Karussell dreht sich auf Hochtouren, doch was sind bloße Redereien und Hirngespinste, was ernst zu nehmende Informationen? Und was hat es zu bedeuten, dass Eustacchio (»Stacchiuccio«), ein Junge aus prekären Verhältnissen, der in der Wohnung über Stellas wohnt, plötzlich spurlos verschwindet?
Wie immer muss sich die Polizei letzten Endes auf mühselige Recherchemethoden einlassen, um an belastbare Indizien zu kommen: Spurensicherung, Zeugenbefragungen, Aktenstudium, Internet. Unter den Personen, mit denen das Opfer in letzter Zeit Kontakt pflegte, sind so interessante Charaktere wie Niccolò de Nardis, aus uraltem, wenn auch inzwischen mittellosem Adel, aber noch immer im Besitz der imponierenden Insignien seines Standes – geräumiger Stadt-palazzo, Jaguar E-Type, arrogantes Wesen. Dass sich der längst nicht mehr ganz feine Herr gelegentlich von barmherzigen Dörflern zu einer warmen Mahlzeit einladen lässt, kann er mit seinem gesunden Geschäftssinn durchaus vereinbaren.
In einer Kiste, die Stella entsorgt hat, findet man eine Menge zerbrochener Glasnegative aus der Pionierzeit der Fotografie. Pikanter als die Schlüpfrigkeiten auf vielen der Scherben sind die Spuren in die ersten Jahre des italienischen Königreichs, als das piemontesische Militär brutal gegen aufmüpfige Dörfler und Briganten im Süden vorging, um nach dem risorgimento die neue Zentralmacht aus dem Norden zu sichern. Dabei haben auch Vorfahren von De Nardis mitgemischt.
Immas rechte Hand bei der Arbeit ist der zuverlässige und dienstbeflissene maresciallo Ippazio Calogiuri, überdies ein geradezu gefährlich attraktiver Mann, wie seine Vorgesetzte betont. Die beiden müssen einander schon näher gestanden, sich aber überworfen haben, wie vielfach angedeutet wird. Die diffizile Beziehung ist also ein roter Faden durch die gewiss noch weiterzuführende Serie. Andere Mitarbeiter zeichnen sich in Immas Augen vorzugsweise dadurch aus, dass sie keine dummen Bemerkungen machen, bei Autofahrten nicht ihr Privatleben ausbreiten und vor allem die Launen ihrer Chefin widerspruchslos ertragen.
Die Handlung spielt in der süditalienischen Region Basilikata. Matera, die Provinzhauptstadt, verdankt ihren Ruhm den unzähligen Höhlen, die Natur und Mensch in die weichen Abhänge der Tuffsteinschluchten getrieben haben und die seit Jahrtausenden besiedelt sind. Das verwirrende System neben- und übereinander gestapelter Ein- und Mehrraumwohnungen, Gässchen, Treppchen, kleiner Plätze und Felsenkirchen (»chiese rupestri«) mit byzantinischen Fresken bildet ein pittoreskes, biblisch anmutendes Ensemble, in dem Filme wie Pier Paolo Pasolinis »Das 1. Evangelium – Matthäus« und Mel Gibsons »Die Passion Christi« gedreht wurden. So einmalig und beeindruckend die Architektur und das eher an eine Skulptur erinnernde Stadtbild ist, so menschenunwürdig waren die Bedingungen, unter denen Mensch und Vieh in den engen Grotten ohne fließend Wasser und Elektrizität hausten, von Malaria, Typhus und Cholera bedroht. Um 1950 erregten die Sassi (die beiden Stadtteile Sasso Caveoso und Sasso Barisano) als »la vergogna d’Italia« Aufmerksamkeit, und Staatspräsident Alcide De Gasperi initiierte ein Gesetz, um die etwa 17.000 Bewohner auf Staatskosten in neu errichtete Stadtviertel wie den Rione Serra Venerdì umzusiedeln.
Spätestens seit die Sassi 1993 zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt wurden, verändern sie ihr Gesicht. Schicke Büros, moderne Ferienwohnungen, Boutiquen, Trattorien, Kunstgewerbe und Museen wurden in uralten Höhlen eingerichtet, um den wachsenden Besucherstrom zu bedienen. Mit der Wahl Materas zur Europäischen Kulturhauptstadt 2019 ist die Stadt endgültig als Touristenattraktion arriviert – und mit Mariolina Venezias Büchern auch literarisch zeitgemäß vertreten. Die Autorin ist eine fähige Botschafterin ihrer Heimat, der die Vielfalt der Handlungsschauplätze am Herzen liegt. Es sind Grotten in den Sassi und Wohnungen im Viertel, das dem Buch den Titel gibt, dazu die Landschaften der lukanischen Dolomiten, einer spröden, einsamen, bergigen Gegend, die im Winter einfriert und im Sommer verbrennt, in deren Dörfern, auf endlos gewundenen, engen Sträßchen zu erreichen, die Zeit stehengeblieben ist.
Mariolina Venezia hat viele Jahre in Frankreich gelebt, was ihren Horizont geweitet hat, und Gedichtbände veröffentlicht, die ihre sprachliche Sensibilität belegen. Ihr Kriminalroman ist sprachlich anspruchsvoll – vor allem, wenn uns innere Monologe der Protagonistin mit Gedankenfetzen, umgangssprachlichen Floskeln und bloßen Andeutungen in Satzbrocken hingeworfen werden. Die Erzählung ist unterhaltsam, amüsant und voller Ironie, die Spannung wird von allerlei Cliffhangern angeheizt, aber bis zur Lösung des Falls müssen wir an Immas Seite viele Irrwege gehen. Gelegentlich wird Imma auch nachdenklich: »Lei alle norme aveva sempre creduto, che c’entra, fin da ragazza, quando per rispettarle non passava le versioni [gemeint ist: Weil das gegen die Regeln verstößt, ließ Imma ihre Mitschülerin nicht ihre Griechisch-Hausaufgaben abschreiben.], ma in quel momento, da lontano, le venne un pensiero: che certe volte la legge è un paravento, buono a nascondere le cose che non fanno comodo.«
 · Herkunft:
· Herkunft: