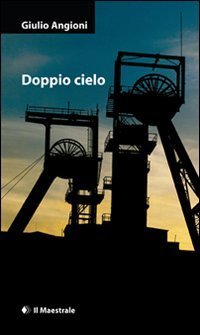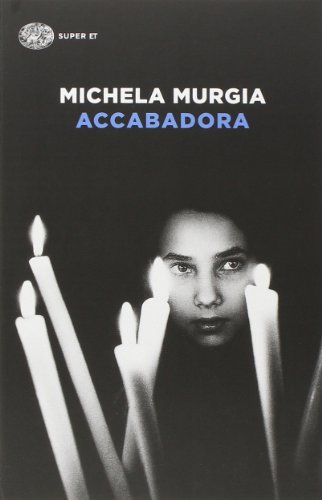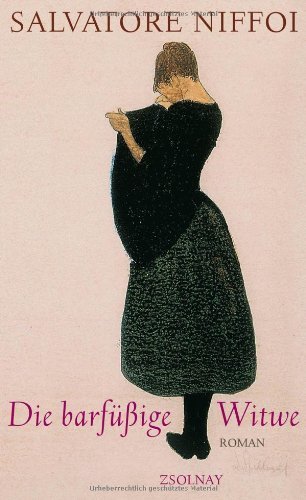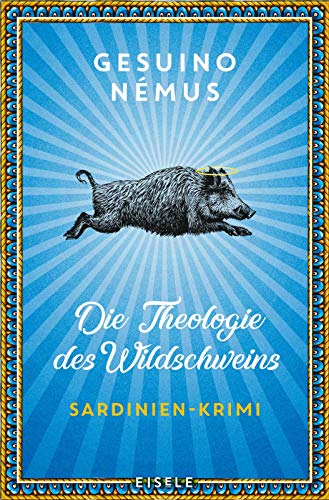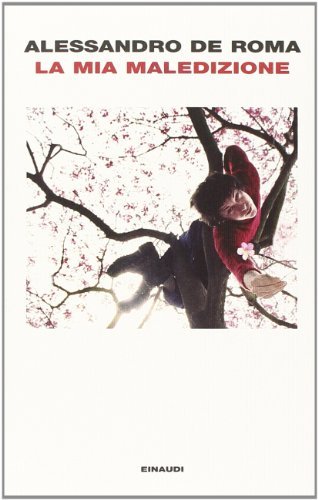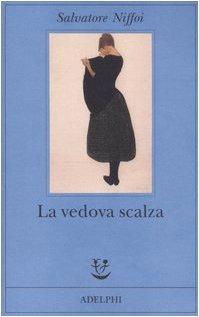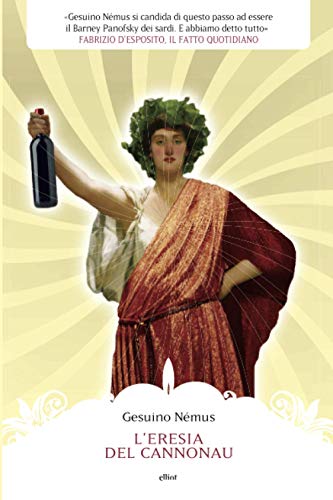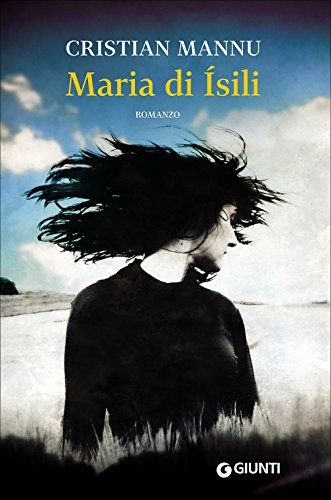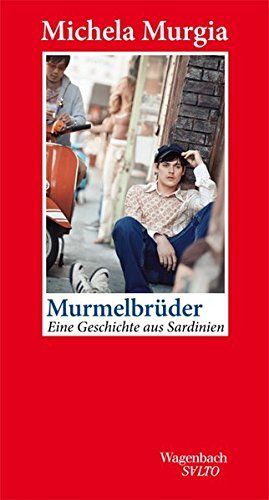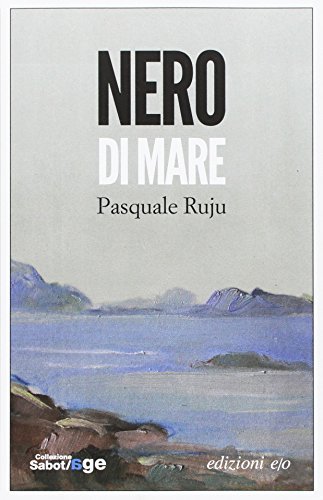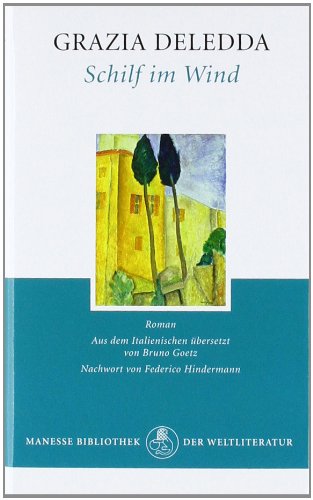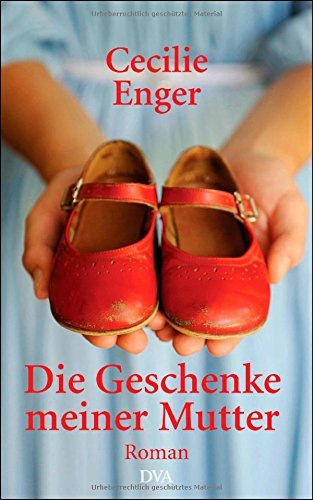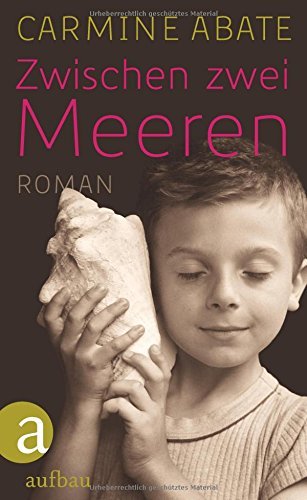Eine Insel der Hoffnung
Wohin fliehen, wenn in kriegerischen Zeiten Lebensgefahr droht? Dahin, wo Krankheit und Tod wohnen. Deshalb zieht es Mannai Murenu auf die Insel der Aussätzigen. Dorthin wird ihn keiner der Pisaner verfolgen, die Santa Gia nach Monaten der Belagerung zerstört, seine Einwohner getötet, als Rudersklaven oder Huren verschleppt und die Ruinen mit Salz überstreut haben. Auch das Haus des Weinhändlers Nanni Pes legten die Soldaten in Schutt und Asche. Mannai, der siebzehnjährige Gehilfe des vinaio, überlebte, indem er sich, unter den Trümmern begraben, drei Tage lang tot stellte.
Santa Igia, »la magna città«, »nostra Santa Gia, che benedetta sia nei secoli dei secoli«, war bis zu ihrer Vernichtung im Juli 1258 die blühende Hauptstadt des Giudicato di Cagliari gewesen. Giudicato nannte man die vier Königreiche von Sardinien, deren Herrscher den Titel Giudice (Richter) führten. Seit Jahrzehnten stritten Genueser und Pisaner mit ihren bunt gemischten Söldnertruppen um die Vorherrschaft – ein ständiges Kommen und Gehen, Einnehmen und Verlieren, Einreißen und Aufbauen; die Dörfer, Städtchen und Bewohner der Insel Spielbälle der fernen Politik zwischen Ghibellinen, Guelfen, Gherardesca, Visconti, Hohenstaufen, Genua, Pisa und dem Papst; davor waren Griechen, Römer, Araber, Piraten eingefallen, später würden Spanier, Österreicher, Piemonteser folgen ... »I mali maggiori arrivano dal mare«, weiß bis heute jeder Sarde.
In diesem Hexenkessel ist die Insel der Aussätzigen ein ruhiger Ort. In der riesigen Lagune westlich von Cagliari (heute eine Mond- und Industrielandschaft, beim Landeanflug zu bestaunen) gibt es eine Vielzahl größerer und kleinerer Erhebungen, und keine blieb von Kriegsgreueln verschont, nicht einmal die »isola dei lebbrosi«. Von dort holten die Pisaner die Munition für ihre Katapulte. »O voi cani affamati sardi e genovesi, mangiatevi la carne dei lebbrosi vostri«, schrien sie, wenn sie die infizierten Körper über die Mauern von Santa Gia schleuderten. In friedlichen Phasen hatten sich gelegentlich Priester, Händler und Schmuggler zur Ausübung ihrer Geschäfte genähert, und in mancher Nacht war auch Mannai mit seinem padrone vinaio hingewatet (denn alle Boote gehören der jeweiligen Herrschermacht und sind dem einfachen Mann verboten). Daher kennt Mannai die Schleichwege durch Schilf und Salzwasser, die sich mit Wetter und Gezeiten wandeln. Er weiß das Verhalten der Flamingos zu deuten. Er weiß, wie man sich mit einem Schilfschnorchel eine ganze Zeitlang unter Wasser verbergen kann. Er weiß, wie sich die lebbrosi auf ihrer Insel eingerichtet hatten: mit Süßwasser, Gärten, Hütten und einer Seidenraupenzucht, mit deren Erzeugnissen sie den Wein bezahlten.
Auf dem gefährlichen Weg aus seinem Trümmergrab bis zur Insel schließen sich Mannai weitere Flüchtige an, und am Ziel wächst die Gruppe schnell weiter – nach einem Jahr umfasst sie etwa fünf Dutzend Personen. Entwicklung und Wesen dieser Gemeinschaft stehen im Mittelpunkt von Giulio Angionis Roman, und was er entwirft, ist eine Art Utopia der Menschlichkeit, der Weisheit, der Toleranz und der Heiterkeit. Ihr einziger Schutz inmitten einer unberechenbaren Realität der Gewalt, der Unmenschlichkeit, der kurzsichtigen Gier und der ideologischen Verblendung: die isolierte Lage und jedermanns Furcht vor Ansteckung. Doch wie die Stadt Santa Gia wird auch die kleine Gemeinschaft nicht bestehen; moralische Stärke kann nicht viel ausrichten gegen nackte Machtausübung, die Wahrheit nichts gegen die Folter der Inquisition.
Aber Utopie kann ein leuchtendes Vorbild setzen. Ihren idealen Charakter verdeutlicht die generische Benennung: einfach nur »l'Isola Nostra, o solo La Nostra«, »al centro dello Stagno« (auch der ohne Zusatz). Die Bewohner finden sich glücklich zusammen (bzw. vom Autor zweckdienlich kompiliert): Zu Mannai, dem mutigen und geschickten Schmuggler, stößt als Erster der lebenskluge, lernbegierige Paulinu da Fraus, etwa dreißig, halb Schweinehirt, halb Aushilfe im scriptorium des Klosters Santa Maria di Cluso; dann der kauzige Fischer Tidoreddu, um die vierzig, der, wo er geht und steht, ein geheimnisvolles Buch unter dem Arm hütet; er begleitet zwei Frauen, Vera de Tori, offensichtlich feiner Abstammung, und die junge Akì, die es auf abenteuerlichen Wegen aus Persien hierher verschlagen hat. Später folgen drei deutsche Söldner, bewaffnet, aber verletzt , Teraponto, der byzantinische Schmied, und viele weitere. Auch ein wackerer Hund gehört dazu.
Männer und Frauen wie diese – unterschiedlichen Alters, dreier Religionen, etlicher Nationen, vieler Begabungen und Fertigkeiten – jede und jeder bringt Wertvolles ein. Vor allem aber sind alle gleich gestimmt: aufmerksame Zuhörer, verständig, tolerant, vernünftig, basisdemokratisch. Sie lernen und wachsen miteinander. So gelingt es ihnen, ihre Ideale in einem lebenswerten, hierarchiefreien Kollektiv zu realisieren. Die Insel erblüht wieder mit Süßwasser, Fischerei, Gärten, Handwerk, Hütten, dem Glockenturm, der allabendlichen Tafel, Familiengründungen.
Geistiger Inspirator und Lehrer ist der alte, gebrechliche Jude Baruch, »ben oltre il limite biblico dei sessanta più dieci«. Er ist ungeheuer gelehrt, sprüht vor Weisheit und Witz, beherrscht mehrere Sprachen und die Kunst der Seidenraupenzucht. Leben heißt für ihn Vernunft anwenden (»La lebbra non è una punizione divina, da accettare rassegnati, ma è malattia da curare.«). Eine seiner fruchtbaren Anregungen ist, die gemeinsamen Abende mit Erzählen zu verbringen. Er formuliert sozusagen das Credo jedes Romans: »Il mondo prende senso se lo raccontiamo, magari come Shehrazade, la mia compatriota che si salva la vita raccontando.«
Was und wie jeder erzählt, bleibt dem Einzelnen überlassen. Jede Erzählung schafft eine Identität (»Noi siamo per noi ciò che riusciamo a raccontare di noi stessi. E per gli altri siamo ciò che loro raccontano di noi.«), jedes Erzählen hat eine heilende Wirkung: »Così è stato. E fa ancora male. Siamo ancora in guerra e nella guerra. Certi mostrano in silenzio ferite e mutilazioni. Altri non riescono a mostrare e a dire niente, solo qualche smorfia. Certuni neanche quelle. Quando riprendono a dirsi, il giorno o giorni dopo, cercano di tirare qualche filo, di rimettere insieme qualche pezzo, di fare un inventario per ricominciare. E noi lo conosciamo bene tutto questo, noi veterani sull'Isola Nostra, questo cercare una stabilità, ritrovare rapporti, qualche misericordia e compassione, qualche affetto. Ma è difficile. Se ci sono parole, non hanno ancora coerenza di discorso.«
In den ersten Sätzen und danach gelegentlich deutet Mannai Murenu als Ich-Erzähler eine Rahmensituation an: Siebzig Jahre nach den Ereignissen wurde er offensichtlich gebeten, seine Erinnerungen als Überlebender der Zerschlagung des Giudicato di Cagliari mitzuteilen. Im Verlauf einiger Tage berichten er, Akì und Vera einem anonymen Zuhörer. Damit sind Erzählsituation und Perspektiven mehrfach gebrochen und relativiert. Die drei Erzähler haben den nötigen Abstand gefunden, um ihre Erlebnisse einschließlich der vielen gehörten Erzählungen aus einer bösen Zeit abgeklärt zu vermitteln. Sie wechseln zwischen spannender Dramatisierung, sachlichem Bericht und abwägender Reflexion, ihr Stil ist anspruchsvoll mit Sinn für Ästhetik und Poesie, der Grundton zuversichtlich, hoffnungsfroh, manchmal melancholisch. Zahlreiche Aphorismen würzen die Dialoge (»Attento a ciò che desideri, perché si può avverare.« – »Chi aumenta sapere aumenta dolore.« – »La persona che più temerai di contraddire sarai sempre tu stessa.« – »Nessuno capisce la libertà come chi è servo e non ce l'ha.« – »Servo è chi aspetta qualcuno che venga a liberarlo.«).
Als erstes Werk ihrer gemeinsamen Reihe »Indies« haben die Verlage Il Maestrale und Feltrinelli ein schönes, kluges, bewegendes Buch herausgebracht: Tief verwurzelt in Landschaft, Atmosphäre und Geschichte Sardiniens, erzählt es vom Aufbruch einer Gemeinschaft in eine bessere Welt und von ihrer Vernichtung. Besonders geistvoll: das Kapitel »Un libro che cos'è« ...
Der Sarde Giulio Angioni (1939-2017) ist einer der profiliertesten Kultur- und Sozialanthropologen Italiens. Er hat in Deutschland studiert und in Frankreich und England gelehrt, ehe er Professor und Institutsdirektor an der Universität Cagliari wurde. Ebenso wichtig wie seine wissenschaftlichen Arbeiten sind seine literarischen Werke (Erzählungen, Romane, Lyrik). Für die neueste Entwicklung der sardischen Literatur hat Angioni wegweisende Beiträge geleistet; er zählt mit Sergio Atzeni und Salvatore Mannuzzu zu den Begründern der »Neuen sardischen Literatur« [› Überblick »Sardische Literatur aus hundert Jahren«].
P.S.: Die ersten beiden Kapitel (von 37) können Sie auf der Webseite der Tageszeitung »La nuova Sardegna« lesen – klicken Sie hier.
P.P.S.: Wenn Thematik und Stil Sie ansprechen, gefällt Ihnen sicher auch der Roman »L'ora di tutti« von Maria Corti; er handelt von der Belagerung Otrantos durch die Türken 1480 [› Rezension].
 · Herkunft:
· Herkunft: