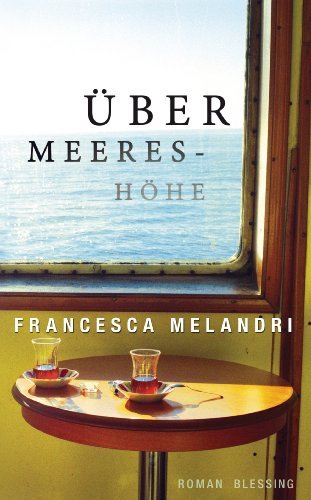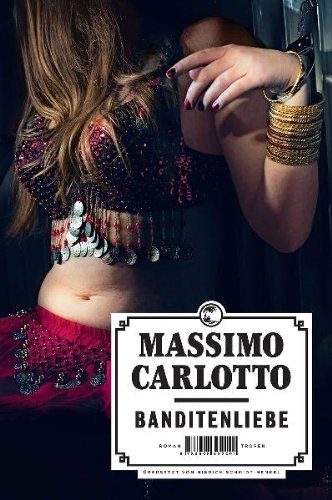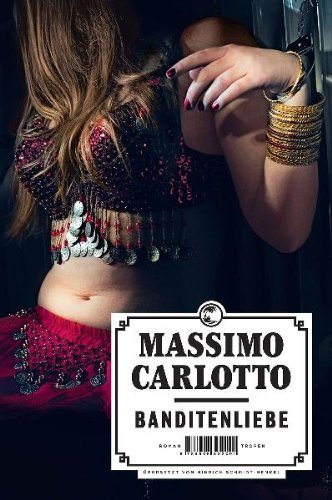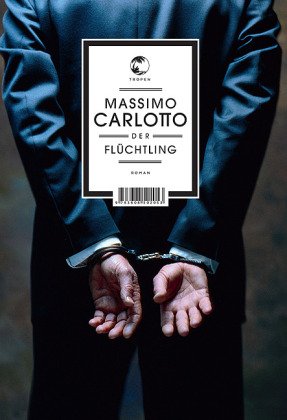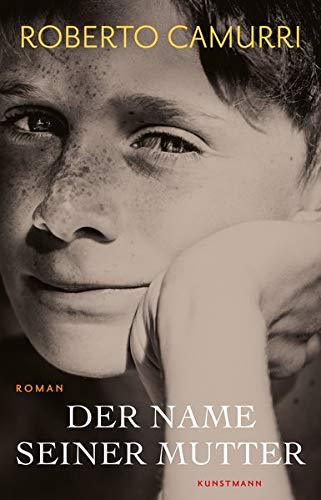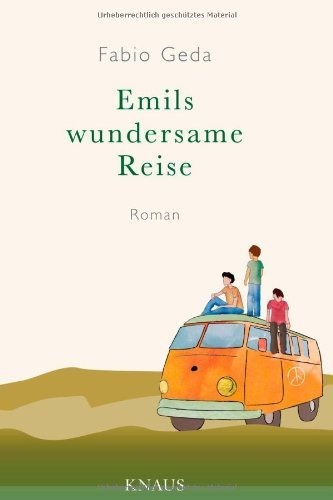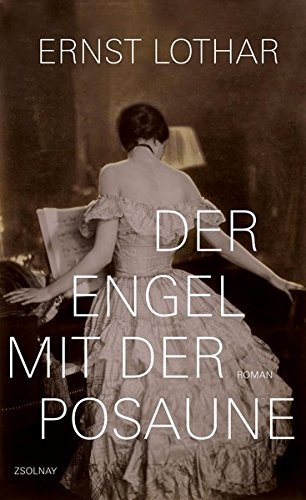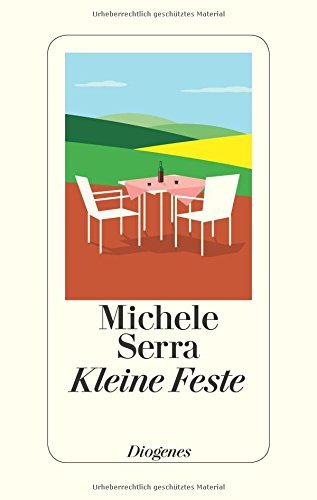
Mal mir einen Frosch!
Kurzgeschichten mag man oder nicht. Sie sind eben ›nur‹ literarische Pralinen – ein rascher Reiz, ein kurzer Genuss, schnell konsumiert, von der nächsten überlagert, verdrängt, vergessen, zu winzig, um prägenden Eindruck zu hinterlassen. Doch die Begrenztheit ist ihre Stärke. Erfunden, um mit dem Boom des amerikanischen Zeitschriftenwesens im neunzehnten Jahrhundert wachsende Lesermassen zu unterhalten, passen Kurzgeschichten in unsere Zeit besser denn in jede zuvor. Sie fordern nicht viel Freizeit, wenig Speicherplatz, sind mobil konsumierbar, stilistisch vielseitig wie Musikvideos, und sie sättigen nicht. Aber man unterschätze nicht ihren Nährwert. Wenn sie gut gemacht sind, sendet so ein Textchen ein Blitzlicht in eine der vielen dunklen Ecken der menschlichen Existenz, und man erschrickt, staunt, freut sich oder ist gerührt von dem, was da womöglich erst- und letztmalig kurz aufleuchtet. Alles weitere bleibt dem Leser überlassen.
Michele Serras Kurzgeschichten sind gut gemacht – tatsächlich eher »kleine Feste« als »Cerimonie«  , wie der italienische Originaltitel lautet. Julika Brandestini hat die Geschichten, die in Italien bereits 2002 erschienen und mit dem Premio Elsa Morante der Insel Procida ausgezeichnet wurden, jetzt erstmals ins Deutsche übersetzt. Michele Serra, 1954 geboren und bei uns weitgehend unbekannt, ist in Italien auf mehreren Feldern präsent. Der streitbare Linke und bekennende Homosexuelle hat sich als Kolumnist, Journalist, Schriftsteller, Fernsehautor, Humorist, Satiriker und Textschreiber für Beppe Grillo einen Namen gemacht.
, wie der italienische Originaltitel lautet. Julika Brandestini hat die Geschichten, die in Italien bereits 2002 erschienen und mit dem Premio Elsa Morante der Insel Procida ausgezeichnet wurden, jetzt erstmals ins Deutsche übersetzt. Michele Serra, 1954 geboren und bei uns weitgehend unbekannt, ist in Italien auf mehreren Feldern präsent. Der streitbare Linke und bekennende Homosexuelle hat sich als Kolumnist, Journalist, Schriftsteller, Fernsehautor, Humorist, Satiriker und Textschreiber für Beppe Grillo einen Namen gemacht.
Zwölf bemerkenswerte Kurzgeschichten versammelt das hübsche Leinenbändchen aus dem Diogenes-Verlag. Das Inhaltsverzeichnis stimuliert die Fantasie: zwölf Satzanfänge, die alle dem Text der jeweiligen Erzählung entnommen sind. »Die Parteigänger der Schleifmaschine und die des Schmirgels«, »Wer wusste schon, wann der Hirsch endlich röhrte«, »Gongs im Bambuswäldchen, Dudelsäcke in den Bergen und Harfen auf der Heide« – was mag einen da wohl erwarten?
Alle Geschichten sind aus der Ich-Perspektive verfasst, geben sich also realistisch, authentisch, womöglich autobiografisch. Die Situationen, in die der Autor seine Figuren stellt, sind jedoch nicht immer alltäglich. Gleich in der Eingangsgeschichte sind wir »ergriffen« von dem alten Mann, der sich vor uns am toskanischen Flussufer ungeniert seiner Kleidung entledigt und so, wie Gott ihn geschaffen, ins Wasser begibt. Man kommt ins Gespräch (»ich bin ein Freund alles Irdischen«), der Alte gibt Spinnertes und Bedenkenswertes von sich. Was ihn umtreibt, ist der Zwiespalt, dass er Atheist ist, aber einen starken Drang zu beten verspürt. Nicht Leid, Verzweiflung oder Angst will er einem Gott kommunizieren, sondern sein Glücksgefühl, leben zu dürfen. Überzeugt, dass der Mensch ein Gemeinschaftswesen sei, will er eine Gebetsgruppe begründen und dem Gottesdienst der Priester eine diesseitige, rein humane Liturgie entgegensetzen. »Der ist verrückt«, denkt der Erzähler bisweilen, lässt sich aber ein auf diese abenteuerliche, inspirierende Melange aus Soziologie, Philosophie (»Sind alle Esel als Esel geboren?«) und Religion (»wir bildeten eine kleine Abendmahlrunde«). Schließlich soll eine Art Vergeistigung im Angesicht der Naturschönheiten helfen, einen »eigenen Ritus« der Ungläubigen zu erfinden. Obwohl auch das nicht so recht klappen will und wir den kauzigen Alten, notgedrungen unserem Erzähler folgend, seinem Schicksal überlassen müssen, hat er doch viele Schlaglichter auf den Sinn des Lebens, die Religionen, Schönheit, Werte, Worte und Literatur geworfen.
Serras Kurzgeschichten punkten nicht durch äußere Handlung. Die ist ziemlich unaufgeregt, aber originell, gern etwas skurril oder absurd und insofern durchaus überraschend und unterhaltsam. Größeren Raum nehmen jedoch die vielfältigen Überlegungen ein, die die Geschehnisse beim Erzähler auslösen. Er charakterisiert die Personen, analysiert, was in ihnen vorgehen mag, assoziiert dieses und jenes und erweitert seine Gedankenflüge regelmäßig in philosophische und spirituelle Sphären. Auffallend oft ringt er mit der Not des »Entchristianisierten«, die Sehnsucht nach »Höherem« zu stillen, die Leerstellen der Trostlosigkeit zu füllen, seit er all die »theologischen Märchen [...] in die Mottenkiste meiner katholischen Erziehung verbannt hatte«. Es sind gewissermaßen ›essayistische Erzählungen‹, die Alltagssituationen einer eingehenderen Betrachtung unterziehen.
Dass der Leser sich gern von diesen Geschichten fesseln lässt, liegt auch an Serras kunstvollem Stil, der humorvolle Leichtigkeit, eine ausgeprägte, originelle poetische Bildlichkeit und das komplette Spektrum kritischer Aussageweisen von sanften Anregungen über leichte Ironie bis zu beißendem Sarkasmus vereint.
So lesen wir einerseits – immer aus der Ich-Perspektive –, wie Manlio, Besitzer eines kleinen Ladens in der Via Pacini (eine Mailänder »Hundescheißmeile, mindestens zwei Kilometer voller alter, scheppernder Blechjalousien«), kein Blatt vor den Mund nimmt, wenn es um die »Nichtexistierenden« mit »idiotisch rasierten Militärköpfen« geht, deren armselige »Identität einzig aus einem blau-violetten WOW besteht, das sie nachts neben ein identisches POW sprayen«. Ihr »stumpfsinniges Alphabet« von »Ich bin auch noch da«-Botschaften verschandelt ganze Straßen- und Eisenbahnzüge. Nachdem er selbst ein paar Mal Opfer dieser anonymen »Herren Ich« geworden war und seinen Rollladen mühselig gereinigt hat, legt er sich auf die Lauer – und ertappt tatsächlich einen Täter. Was folgt, ist ein verbales Scharmützel und ein amüsantes »Drama der Identität«.
In »Kleine Tempel der Kindheit« geht es dagegen ganz harmlos zurück in die Kindheit des Ich-Erzählers. Im voll bepackten Fiat 600 fuhr die Mailänder Familie bei glühender Sommerhitze über »Sträßchen, die mehr schlecht als recht ins Gelände eingepasst waren«, an die Riviera di Ponente. Da schweifen die Gedanken von praktischen Fragen (die »Kniekusshaltung« auf dem Rücksitz, und »wie machten wir es eigentlich mit dem Gepäck?«) über die Charakteristik der Autotypen (»die gedrungene Eiform des Wagens mit seinem Eigelb aus Personen«) durch eine Fülle von Reiseimpressionen (die rasierten Nacken der vorne Sitzenden, die draußen vorbeihuschenden »Wassergräben, die Pappelreihen, die hellen Landhäuser«, die durch die offenen Fensterchen hereinwehenden Gerüche, Staubkörnchen, Insekten).
Am rührendsten ist die letzte Geschichte des Bandes. Wie tröstet man ein Kind, das über einen schmerzlichen Verlust in Tränen aufgelöst ist? Die warmherzige Anteilnahme, das Mitleiden des Vaters dringt durch die milde Ironie und die kühne Bildlichkeit der Beschreibungen ungeschwächt hindurch. »In seinem Gesicht, auf dem die Züge noch immer auf kleinstem Raum versammelt waren, weinte alles auf einmal. Das Kinn war unter den abwärts gezogenen Lippen zusammengekrampft und glänzte wie ein nasser Tischtennisball. Aus den Augen tropfte eine unglaubliche Menge Tränen, alle paar Sekunden eine, mit dem unfehlbaren Eifer einer Wasseruhr.« Wie sich Giovanni vom »Regenrohr unserer Familie«, der deren »ganzen Tränenwolkenbruch« sammelt und zur Erde ableitet, schließlich zurück ins Leben läutert (unter anderem »geschäftsmännisch wie alle Kinder«), gibt Anlass, über Vertrautheit, Männer und Frauen als Trauernde, das Jenseits, Leben und Tod (»Hebamme und Totengräber arbeiten am selben Strang, wenn auch in verschiedenen Gewerkschaften«) und den ewigen Kreislauf des Wassers nachzudenken.
Schöne, unterhaltsame und überaus anregende Lektüren für Zwischendurch!
 · Herkunft:
· Herkunft:  · Region: Norditalien
· Region: Norditalien