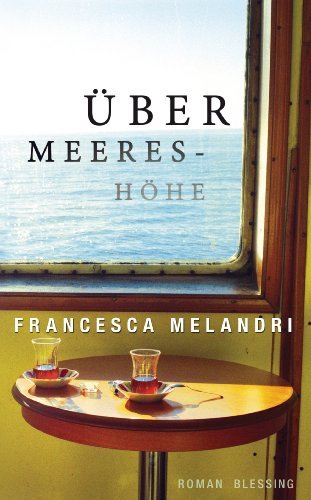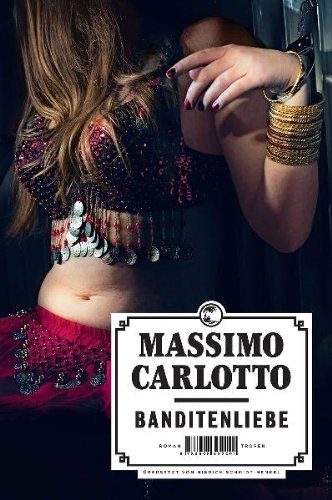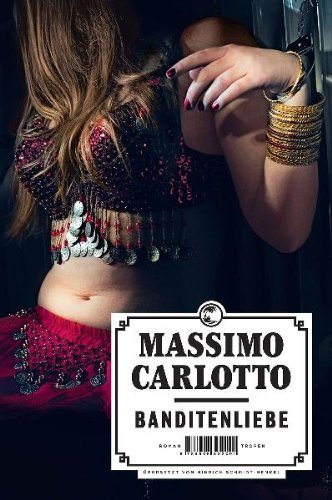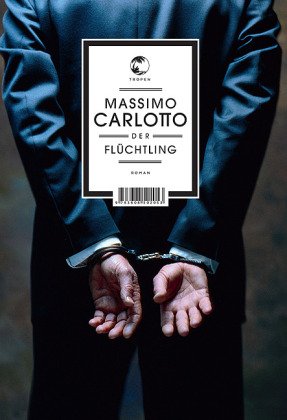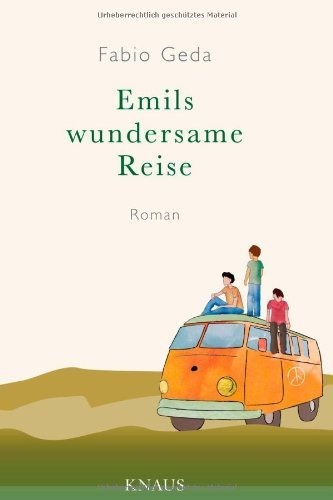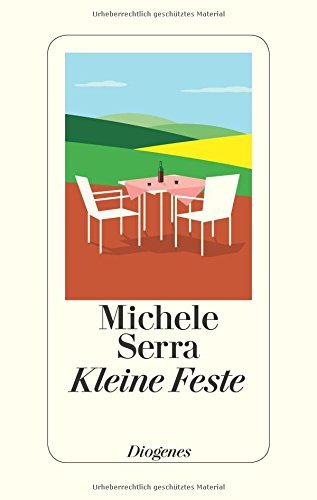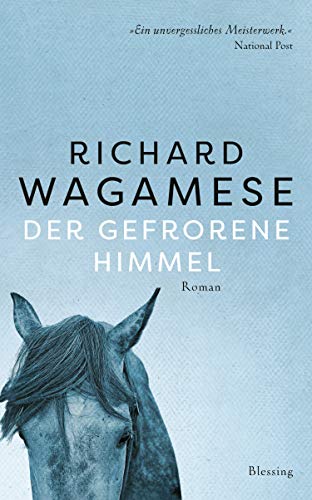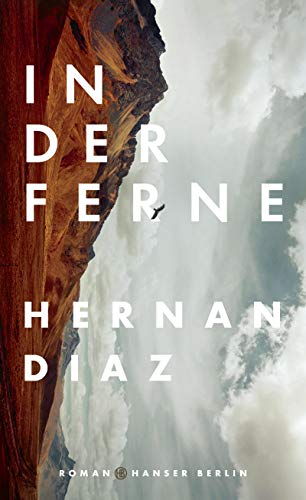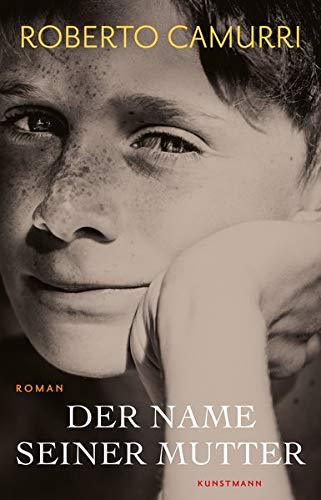
Der Name seiner Mutter
von Roberto Camurri
Ohne Abschied verlässt eine Frau ihren Mann und ihr Baby. Obwohl sie in den Gedanken des Mannes auf quälende Weise präsent bleibt, wird nie über sie gesprochen, und der Sohn wächst mit einer tiefen Leerstelle auf, als hätte seine Mutter nie existiert.
Gemeinsam alleine
Die Po-Ebene in der Emilia-Romagna ist eine Landschaft, die wie gelähmt erscheint. Teilnahmslos fließt der Strom dahin, bewegungslos liegen die Felder in der endlosen Ebene, darüber entweder die aus gleißendem Himmelsblau sengende Sonne oder flirrender Dunst oder nass-fahler Eisnebel. Gelegentlich tauchen Gehöfte, Wassertürme und Rohbauten auf Stelzen auf und geben dem orientierungslos schweifenden Auge ein Ziel. Weit in der Ferne glitzern im Norden und im Süden die Schneespitzen der Bergketten.
In Roberto Camurris Roman, den Maja Pflug ins Deutsche übersetzt hat, fängt selbst die sprachliche Gestaltung diese Atmosphäre ein. Lange Reihen endloser Schachtelsätze ziehen sich, inhaltlich randvoll wie der Strom, durch die Seiten, Dialoge, die Leben einfangen könnten, sind auf das Notwendigste reduziert, selbst ihre Satzzeichen eingespart. So erzählt uns der Autor die Geschichte von Pietro, angefangen mit seiner Geburt über seine Kindheit und Jugend bis zur Gründung seiner eigenen Familie.
Pietro wächst in dem trägen Kaff Fabbrico auf, wo es keine Arbeit und keine Hoffnung gibt, die Menschen die Dinge hinnehmen, wie sie kommen, sich mit Alkohol oder Drogen betäuben, wenig sprechen, nie kämpfen, kaum leben. Kaum anders ist sein Vater Ettore, der ihn schweigend großzieht.
Wer in diesem totenstillen Bild physisch fehlt, ist die Mutter. Monate nachdem sie das Kind zur Welt gebracht hat, sehnt sie sich nach Stille, denn Pietro ist anstrengend, ein Schreikind. Oft quält ihn Keuchhusten, bis er fast erstickt. Sein nächtliches Weinen »klettert die Wände im Flur entlang, um hier zu explodieren, in ihrem Schlafzimmer«. Ettore, der die übermüdete Mutter und das leidende Baby einfühlsam umsorgt, ergreift eines Tages die Initiative und fährt mit dem Söhnchen, wie es die Kinderärztin geraten hat, für einen Tag in die Berge, wo die kühle, saubere Luft ihm Erleichterung und dem erschöpften, der Liebe entwöhnten Vater etwas Abwechslung verschaffen soll.
Als Ettore zu Hause eintrifft, ist seine Frau weg, einfach so, ohne jede Nachricht. Er martert sich mit Selbstvorwürfen, fragt sich, was er falsch gemacht habe, würde gern die Zeit zurückdrehen, versinkt in Schweigen, erstarrt in seinem Leid, gerät in Wut, wenn er Pietros Ähnlichkeiten mit der Mutter entdeckt. Auch das Baby scheint die Veränderung zu spüren, wird still, strampelt kaum.
Eine wichtige Stütze der beiden sind Ettores Schwiegereltern Livio und Ester, die Pietro zeitweise betreuen und mit ihrer zupackenden Lebensfreude stärken. Doch im Innersten sind auch sie erschüttert.
Camurris Intention legt auf Emotionen an. Den weiteren Verlauf seines aufwühlenden Plots beherrschen die tiefen Wunden der Zurückgelassenen. Am schwersten zu tragen hat Pietro, der ohne Erklärungen ganz auf sich allein gestellt bleibt. Zwar kennen auch die Erwachsenen nicht die Beweggründe der Mutter, für Pietro aber ist sie nichts als ein tabuisiertes »Phantom«, ohne Charakter, ohne Geschichte, ohne Namen sogar. Fragen nach ihr zu stellen scheut er sich, denn Ettore wirkt auf ihn unzugänglich und abweisend. In Pietros Verhalten und seinen Gesichtszügen wird der Vater »für immer [die Mutter] sehen« – ein lebender Vorwurf vor seinen Augen.
So tastet sich Pietro zaghaft, unsicher und ergebnislos im Dunklen voran, ohne dass sich seine emotionale Entwicklung jemals frei entfalten kann. Im Gefühlschaos seines Vaters gefangen und hin und her geworfen, erlebt der Junge unkontrollierte Ausbrüche, unverständliche Aggressionen ebenso wie Glücksmomente. Sein Dasein ohne Antworten lässt schlimmste Verdächtigungen aufkommen: Hat Vater seine Frau womöglich umgebracht? Oder trägt Pietro selbst die Schuld daran, dass Mamma gegangen ist? In einem ihrer Tagebücher liest der junge Erwachsene: »Heute ist ein guter Tag, er hat nur sechzehn Stunden geschrien.«
Eine ausführlich gestaltete Schlüsselszene führt Pietros Leiden intensiv vor Augen. Ettore kauft einem alten Bauern einen Welpen ab. Die Hundemutter ist an eine Kette gelegt. Mit einem Trick locken die Männer das Junge von ihr weg. Die Hündin bellt, jault, heult, erwürgt sich fast an der Kette, und Pietro kann der erschütternden Tragödie kaum zusehen, schließt die Augen, hält sich die Ohren zu. Auf dem Heimweg mit dem kleinen Hund fragt er sich, »ob sein eigener Schmerz je vergeht, ob er je aufhören wird, seine Mutter zu vermissen«. Nun hat er hautnah miterlebt, was Trennungsschmerz ist. Was aber ist Liebe? Im Zusammenleben mit seiner Frau fragt er sich, ob sie vielleicht der Ersatz für eine Mutter ist, die er nie hatte.
Roberto Camurris Roman ist das triste Psychogramm eines dysfunktionalen Vater-Sohn-Verhältnisses mit unklärbarer Ursache. Auch für den Leser bleiben die Motive der Mutter im vagen Raum winziger Andeutungen, unsere Fragen danach ebenso unbeantwortet wie die des Protagonisten. Ganz am Schluss erhält Pietro eine Postkarte, mit der seine Mutter ihm zur Geburt seines Sohnes gratuliert. So erfährt er immerhin, dass es ihr gut geht, – und endlich ihren Namen.
 · Herkunft:
· Herkunft:  · Region: Norditalien
· Region: Norditalien