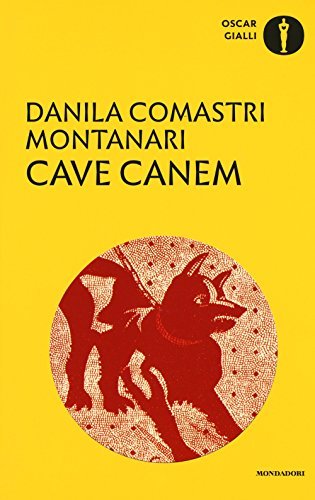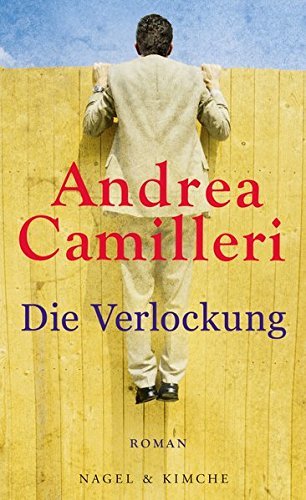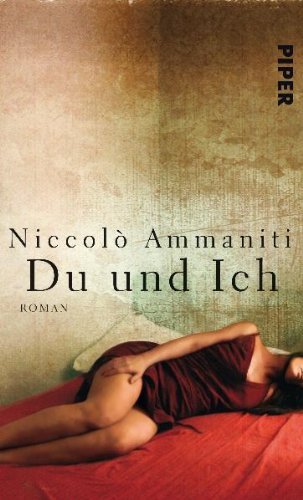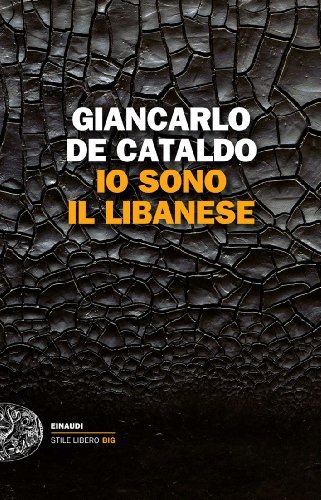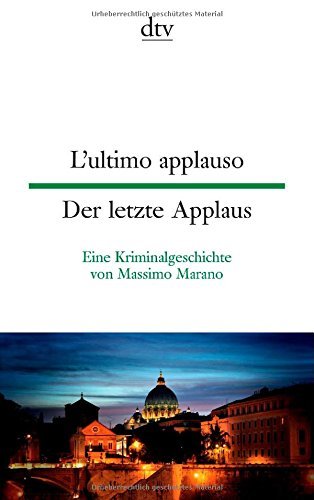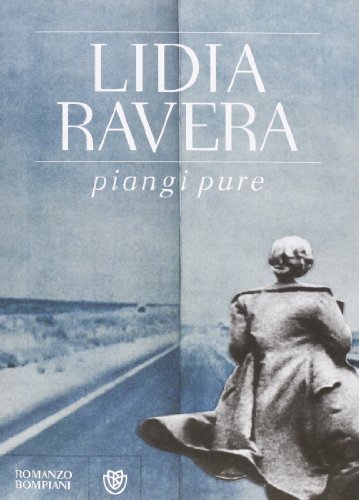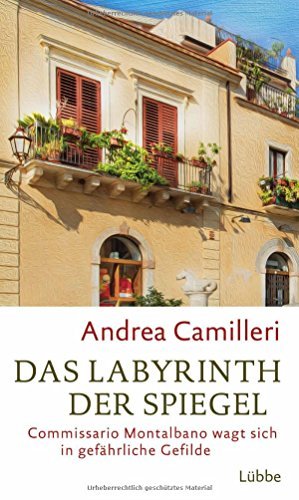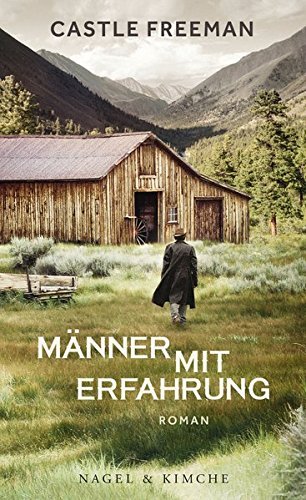Unter dem Mikroskop
Matteo Stella ist ein Familienvater, wie er im Buche steht. All sein Denken und Tun kreist darum, seine Frau Anna (49), Tochter Eleonora (17) und Sohn Stefano (13) glücklich und frei zu sehen. Jegliche eigene Bedürfnisse stellt er hintan.
Matteo leiten wunderbare Ideale. Er setzt auf Vernunft und Einsicht, die Kraft der Argumente und das Wirken eines konsequenten Vorbilds. Niemals würde er anderen einen fremden Willen aufzwingen, ihrer Entfaltung Grenzen setzen. Schon über andere zu urteilen bereitet ihm Skrupel. »Bisogna lasciare agli altri il loro spazio, farli sfogare, rispettarne l'autonomia anche se corrode la tua serenità.«
Dank dieses Konzepts und Matteos Persönlichkeit ist die Familie ein Hort gegenseitigen Verständnisses, der Toleranz und der Harmonie. Die Kinder, so scheint es, haben die Ideale und Schlüsseltugenden wie gewünscht verinnerlicht. Und doch tun sich Risse in Matteos Welt auf.
Anna, einst kapitalismuskritische Studentin, hängt auch als Unternehmerin noch rebellischen Idealen nach. Mit provokanten Kampagnen hat sie eine Werbeagentur im Markt etabliert. Ihre Einkünfte begründen den gutbürgerlichen Lebensstandard der römischen Familie. Matteo hat Anna den Rücken freigehalten, auf eine eigene Karriere (er ist Software-Ingenieur) verzichtet. Dass sie mit ihrem engsten Mitarbeiter eine Affäre hatte (oder vielleicht noch hat), weiß er, baut aber darauf, dass sie Annas Bindungen an ihre Familie nicht gefährden kann.
Uneingeschränkt glücklich ist Anna trotz allem nicht. Die Freiheit, die Matteo allen einräumt, macht sie nicht wirklich frei für ihre Selbstfindung; angesichts seines Vorbilds fühlt sie sich unzulänglich und als schlechte Mutter. In dieser Position hält sie sich zurück, obgleich sie sich von Matteo oft einen zupackenderen Umgang mit den Kindern wünscht.
Eleonora, Papas Prinzessin, hat ihren Vater stets bedingungslos bewundert und geliebt. Jetzt nimmt sie ihn in Schutz, wenn Anna oder Stefano sich gegen ihn wenden. Trotzdem verheimlicht sie ihre jüngsten Eskapaden vor ihm. Lorenzo, ein Nichtsnutz von der Straße (Spitzname »il Canaglia«), merkt, dass er bei einer wie Eleonora nicht landen kann, wenn er nicht ein besserer Mensch wird. Das wiederum macht ihn für das Mädchen umso interessanter.
Die tiefgreifendsten Probleme hat Stefano. Seine schulische Karriere droht bald zu crashen, da er seit geraumer Zeit trotzig jede Kooperation verweigert. Intellektuelle Kapazitäten hat er, findet damit aber keine Anerkennung. Seine Begeisterung für die Astronomie etwa liefert nur Anlass, ihn mit seinem Familiennamen und einem Kinderlied aufzuziehen (»Stella stellina, la notte si avvicina.«). Seine sportlichen Leistungen reichen nicht aus, um ernst genommen zu werden, weder beim Schwimmtraining noch in der Fußballmannschaft unter dem gnadenlosen, ordinären Macho-Trainer »Mister Magni«. So muss er sich permanent mit den Demütigungen der lauten Rudelführer herumschlagen, und Francesca aus der Ballettgruppe, die er von ferne bewundert, bleibt für ihn unerreichbar.
Anders als Matteo glaubt, bietet die Familie Stefano keine Orientierung. Mit der großen Schwester und ihren komischen Bekanntschaften kann er nichts anfangen, nicht einmal mehr ohne Sticheleien sprechen. Papa hat nichts als die üblichen Sprüche für ihn, und Mama ist nie zu Hause. Seine Wut bündelt der Junge in ausgefuchsten Provokationen gegen den Vater, die gleichzeitig nach Freiheit und nach Reglementierung schreien und denen Matteo gleichwohl niemals eine Angriffsfläche bietet. Warum kann er keinen Vater wie all die anderen haben, bei denen es kein Nachdenken und keine Zweifel gibt?
Matteo bemerkt, wie sein Sohn ihm entgleitet. Staunend nimmt er auch zur Kenntnis, wie ein Widerling wie »Mister Magni« sich die Zuneigung seiner Herde und die Anerkennung ihrer Väter zu sichern vermag: durch eine groteske Kombination aus schamlosen Erniedrigungen, brutaler Körpersprache und plumpem Zuspruch (»Tarchiato, il collo taurino, il vocione, gridava parolacce e bestemmie ... poi mister Magni se lo strinse al petto fino a fargli male. – Domenica gli fai due gol e li mandiamo a casa. Promettimelo. – Va bene, mister.«).
In zwei gleich langen Teilen ohne weitere Untergliederung erzählt Simone Giorgi (*1981, Rom) in seinem Romanerstling den Verlauf eines einzigen Tages. Es ist der 12. Dezember 2003, an dem die Lage eskaliert (wobei für die Rückdatierung der Geschichte nicht der geringste Grund zu erkennen ist). Schon die Nacht war enervierend. Stefano spielte in seinem Zimmer Tennis gegen die Wand, nicht ohne dem Vater vorher raffiniert die Hände zu binden (»Colpo, silenzio, colpo, silenzio, colpo, silenzio. Lo aveva fatto per strappare Matteo dalle retrovie e trascinarlo sul campo della battaglia finale, spingerlo ad aprire senza permesso la porta su cui c'era un cartello scritto a mano: papà qui non può entrare.«).
Anna muss an diesem Tag mit ihrem Team das Konzept einer extravaganten Kampagne präsentieren. Ob sie den Autohersteller begeistert oder verschreckt, entscheidet über Wohl und Wehe ihrer Firma. Eleonora soll mit Canaglia auf dessen motorino ans Meer fahren. Stefano hat einen Fan-Schal geklaut und will endlich Francesca beeindrucken, aber er weiß auch, dass ein Blauer Brief von der Lehrerin unterwegs ist.
Das Geschehen ragt aus dem Alltäglichen nicht allzu sehr heraus. Geschäft, Schule, Sport, Freud und Leid pubertärer Freundschaften, das Ringen um einen gangbaren Slalom zwischen Führen und Wachsenlassen, Konsequenz und Verständnis – welche Familie muss sich damit nicht herumschlagen?
Die äußere Handlung ist jedoch lediglich die Trägerfolie für das, was Simone Giorgi wirklich interessiert. Wie ein Seismograf analysiert er jede seelische Regung in dieser Familie. Kein Schritt, kein Blick, kein Wort, keine Geste, keine Empfindung, die nicht eine Reflexion, eine Erinnerung, einen Zweifel, eine Befürchtung auslösten. Der Autor erweist sich in allen vier Perspektiven als scharfsinniger Beobachter und überzeugender Formulierer.
Doch was ist sein Anliegen über die kunstvolle Darstellung hinaus? Wir erleben, wie Matteos Beglückungskonzept scheitert, aber der Grund bleibt offen. Ist es die Halsstarrigkeit, mit der er es durchzieht? Flexibler Pragmatismus wäre der leichtere Weg. Es wäre einfach, endlich einmal klare Kante zu zeigen, auf Autorität und kalte Regeln zu setzen, wie es sein Sohn und seine Frau von ihm erwarten. Sich konsequent treu zu bleiben , den Dialog zu suchen, Verständnis aufzubringen, kostet ihn dagegen größte Anstrengung und Disziplin (»La gente pensa che essere miti sia una fortuna, beato lui, non si arrabbia mai. La gente non capisce nulla. Essere miti è uno sforzo senza pari.«).
Oder ist Matteos Konzept falsch – sein Menschenbild, sein Glaube an die Vernunft, seine Obsession, alle glücklich sehen zu wollen? Dazu fehlt es an fassbaren Gegenpositionen. Die Geschichte köchelt in ihrem eigenen Sud vor sich hin. Wie andere Zeitgenossen denken und handeln, dringt zu wenig herein. Dabei bietet doch gerade die italienische Familientradition eine Fülle interessanter Varianten zwischen urkatholischen, patriarchalischen, matriarchalischen, bäuerlich und großstädtisch geprägten Mustern, mit Setups von Großfamilien bis zu Alleinerziehenden und bequemen mammone-Nestern. Zwar erleben alle vier Charaktere, dass es andere Weltanschauungen als die der Familie Stella gibt, und Matteo kennt alle Argumente zur Genüge. Doch unterm Strich überzeugen sie ihn nicht. Weder Diskussionen noch Reflexionen noch der Plot führen am Ende zu mehr als der banalen Einsicht: Wie man's auch anpackt in der Kindererziehung – es ist immer falsch.
Oder ist Giorgis Roman gar eine Generalabsage an die überholte Institution der Familie, die überfordert ist und ihre einzelnen Mitglieder überfordert? Matteo weigert sich zuzulassen, dass Familien zerfallen können, und sei es einfach nur, weil jedes Kind im Wachsen eigene Interessen entdeckt und entwickelt.
Zu viele Positionen bleiben uneindeutig. Jeder Protagonist hat nachvollziehbare und berechtigte Wünsche, handelt dann aber doch oft impulsiv, unreflektiert. Das ist zutiefst menschlich, nur: Was soll dann der gewaltige Überbau von Matteos Prinzipien? Wenn er mit seinem Alltag hadert, suggeriert er sich selbst Halt mit einem Netz selbstgestrickter Theorien: »tu hai una teoria: [...] respira, prima di dire qualcosa di cui ti pentirai. E un'altra: siamo esseri umani, mica palline da biliardo che devono sottostare alla fisica classica secondo cui a ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. E un'altra. E un'altra.«
So leidet Simone Giorgis Erstling unter Missverhältnissen. Der psychologisierenden Erzählweise steht ein allzu flacher, undynamischer Plot über im Grunde alltägliche Themen gegenüber, das aufwändige Sinnieren ermüdet und führt zu keinem Ergebnis. Eine stärkere Raffung hätte das Buch reizvoller gemacht; die Geschichte hätte verlustlos auf 120 Seiten aufbereitet werden können.
 · Herkunft:
· Herkunft: