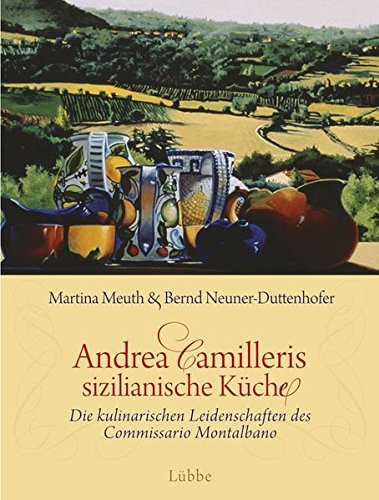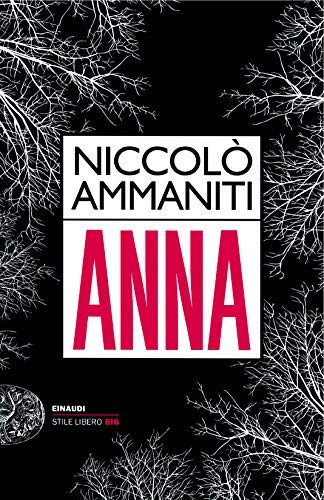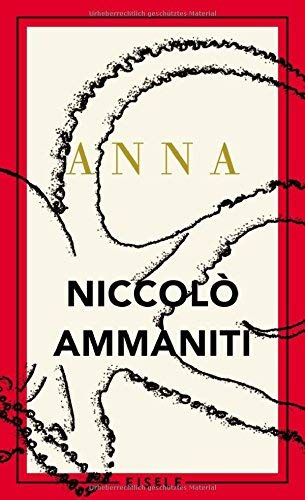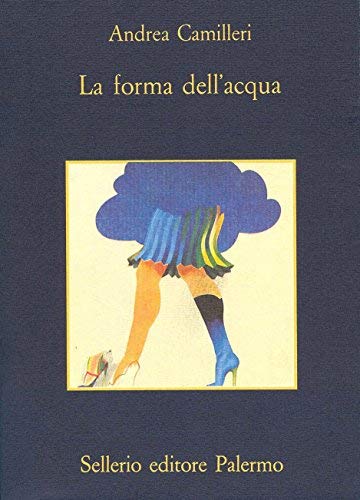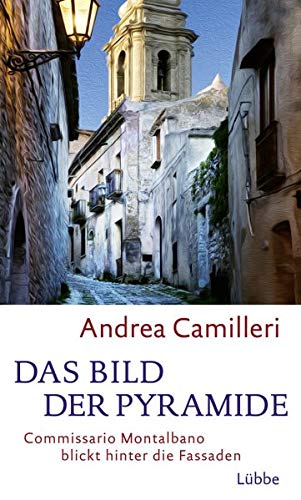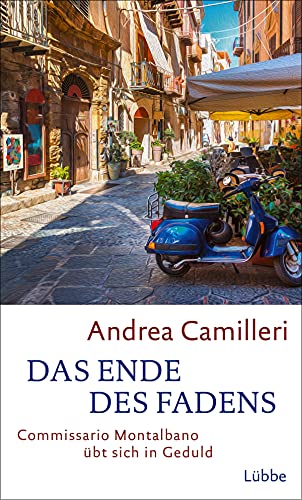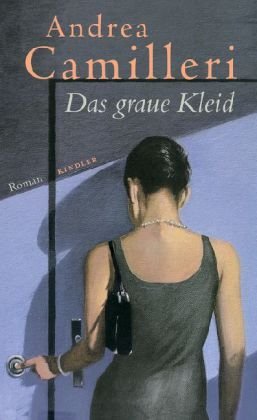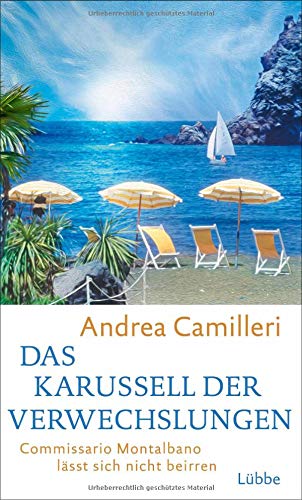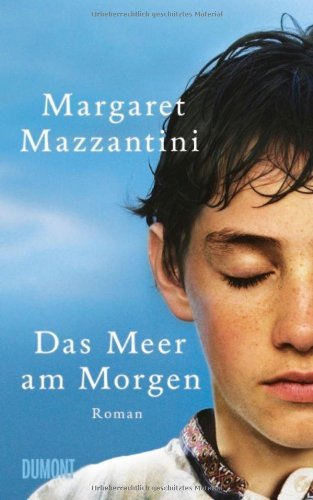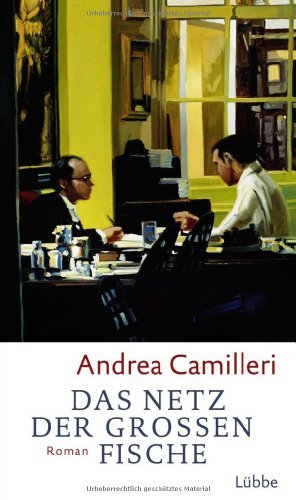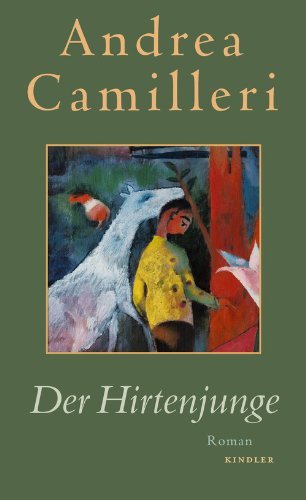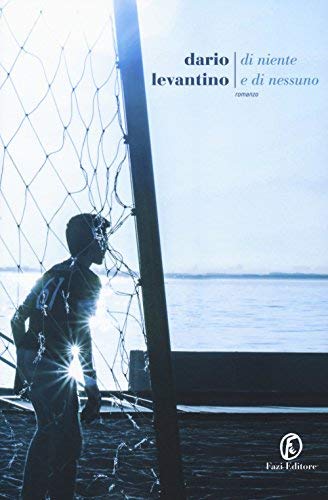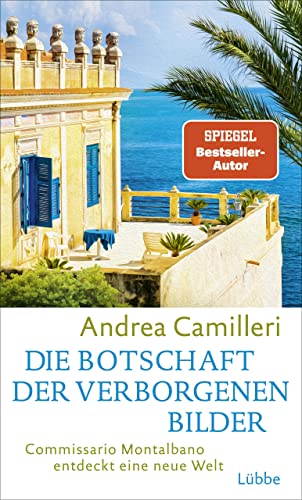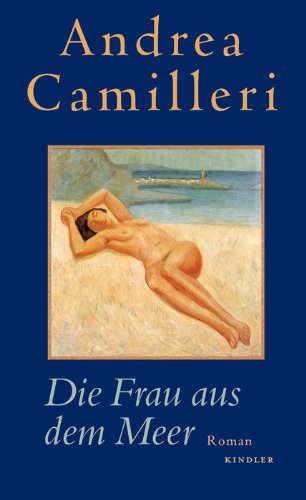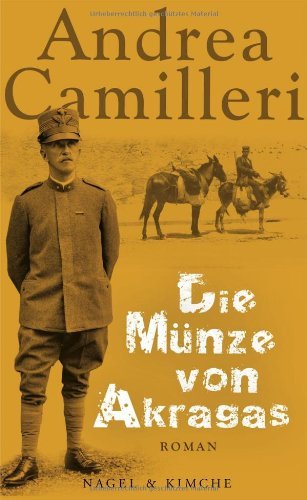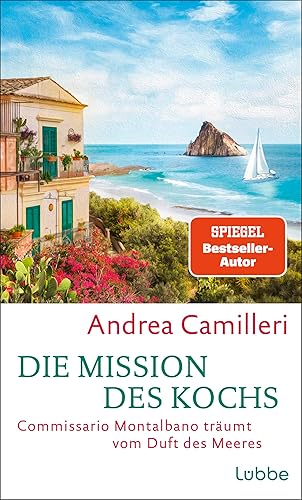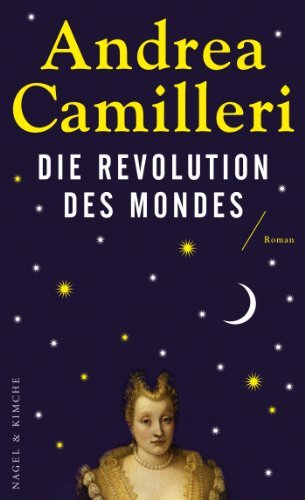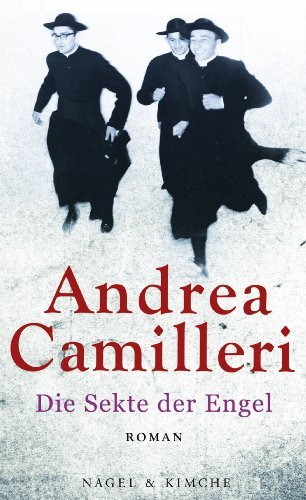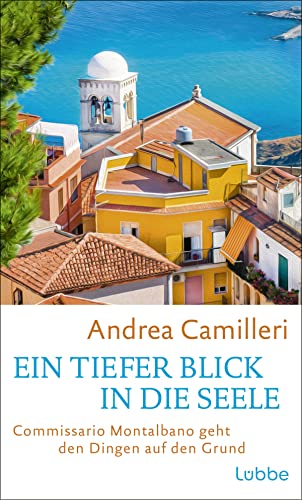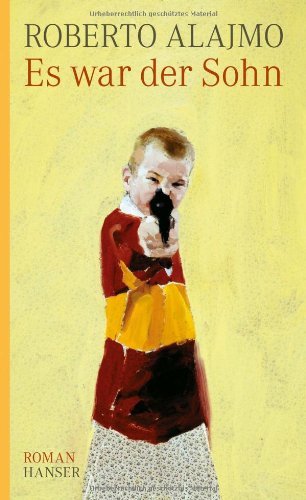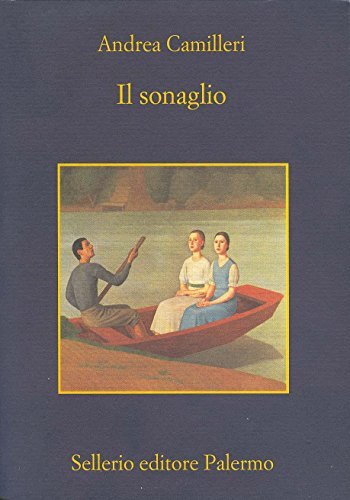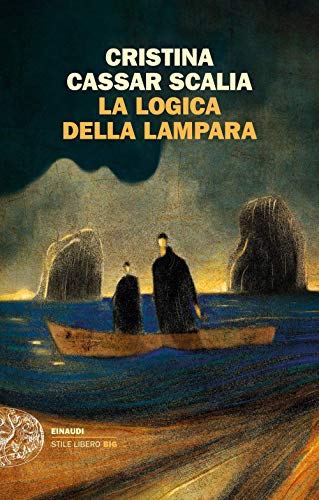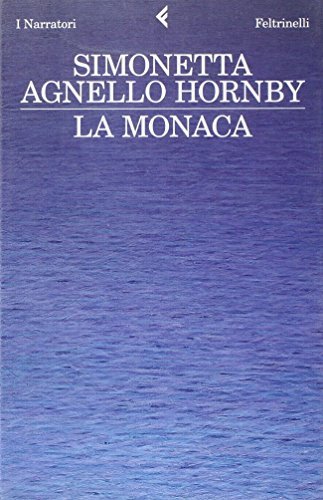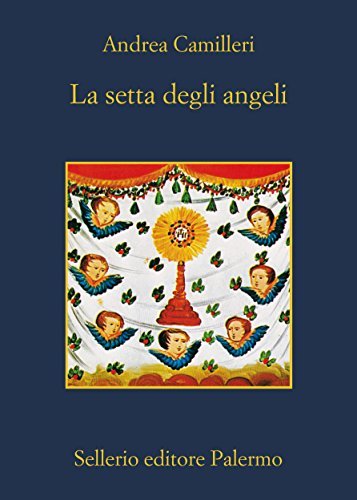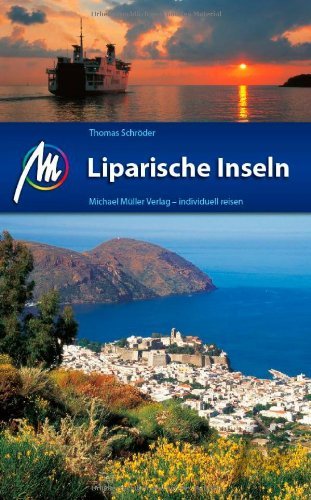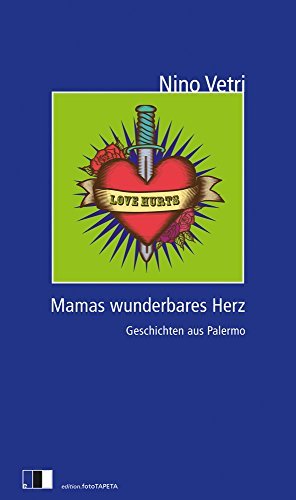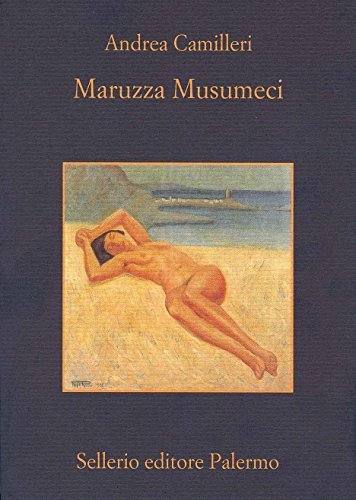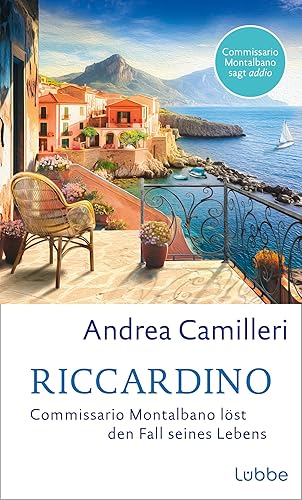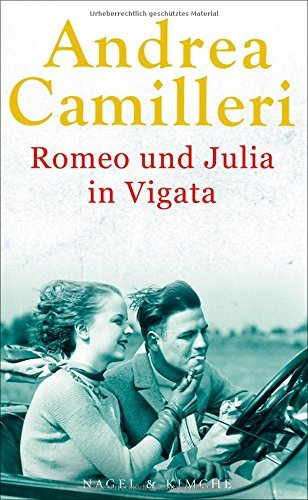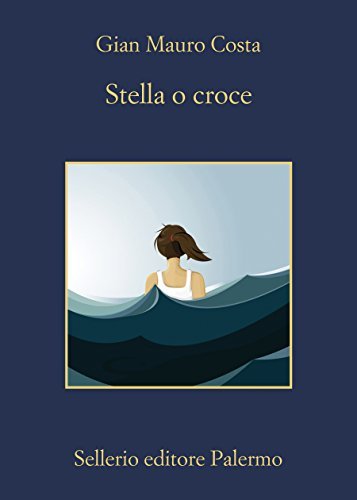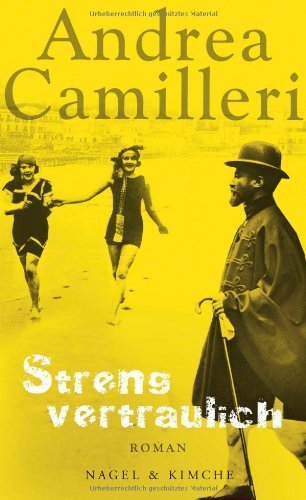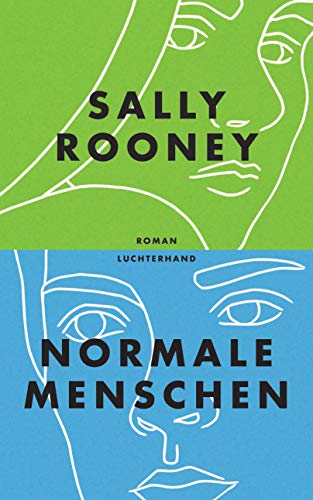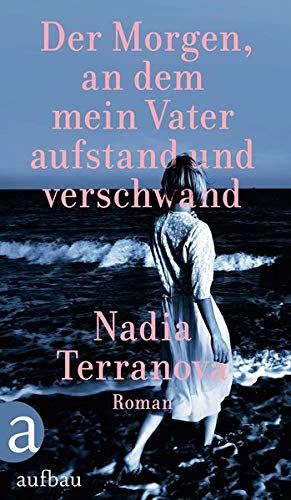
Der Morgen, an dem mein Vater aufstand und verschwand
von Nadia Terranova
Dass ihr Vater Selbstmord beging, als sie dreizehn war, belastet das Leben der Ich-Erzählerin und ihrer Mutter.
Das Leid der Zurückgelassenen
Schwere Depressionen bringen schwer zu ertragendes Leid. Immer mehr Menschen erkranken daran, verfangen sich immer stärker in irrationalen Sorgen, Ängsten, Schmerzen, die sie wie in einem Sumpf ohne Boden tiefer hinabziehen. Mit all dem müssen sie sich in zunehmender Isolation auseinandersetzen, denn ihre Not ist für viele Mitmenschen kaum nachzuvollziehen. Aus der Vielzahl in Frage kommender Medikamente das eine zu ermitteln, das im individuellen Fall helfen könnte, kommt einem Ratespiel mit schmerzvollen Irrwegen gleich, und ist es gefunden, sind Therapien immer noch langwierig. Im Laufe der Monate und Jahre zermürbt die Krankheit Vertrauensverhältnisse, zerbricht Beziehungen, zerstört Familien.
In welchem Ausmaß auch Angehörige und Nahestehende von der heimtückischen Krankheit in Mitleidenschaft gezogen werden, davon erzählt die italienische Autorin Nadia Terranova, 1978 in Messina geboren, in ihrem melancholischen Debütroman »Addio Fantasmi«, den Esther Hansen ins Deutsche übersetzt hat. Es geht darin um die Familie Laquidara aus Messina. Sebastiano, der Familienvater, hat Jahre der Krankheit, der Niedergeschlagenheit, der erzwungenen Untätigkeit durchlitten, bis er sich eines Tages gänzlich unerwartet aus seinem Bett, dem dunklen Rückzugsort, wo er sich sicher gefühlt hatte, erhob, aus dem Haus ging und für immer verschwand. Nie hat man ihn gefunden, nie begraben können. Doch nicht der Erkrankte, nicht sein Leiden und nicht das Geheimnis um sein Ende stehen im Mittelpunkt, sondern die direkten Angehörigen, seine Ehefrau und Ida, ihr einziges Kind. Dreizehn Jahre war sie, die Ich-Erzählerin, alt, als Sebastiano sie und ihre Mutter verließ und dadurch Traumata auslöste, die beide nie überwinden konnten.
Die Vorgänge, die ihre schwere Last bewirkten, sind dem Mädchen nie erklärt worden. Warum hat sich ihr Vater mehr und mehr von einem aktiven Leben in die Isolation zurückgezogen, warum seinen rätselhaften letzten Weg beschritten? Hätte ihre Mutter sich stärker bemühen müssen, um ihn zu retten? Wo hat Ida selber versagt? Zwischen Hass auf die Mutter und Selbstvorwürfen zerreibt sich das Mädchen, während es Spuren in der Vergangenheit auszumachen versucht.
Sebastiano Laquidara unterrichtete Latein und Griechisch an einer Privatschule, Mutter hatte eine Stelle im Heimatmuseum. Mit Beginn der Erkrankung lehnte er sich gegen die heranschleichende Bedrohung auf, erlernte weitere Sprachen, interessierte sich für neue Wissenschaftsbereiche, »las Bücher, um den Klang seines Unglücks zu übertönen, bis ihm offenbar auch diese Anstrengung unerträglich wurde«. Es war hauptsächlich Ida, die sich während dieser Zeit um den Vater kümmerte, ihm die Mahlzeiten ans Bett brachte. Wie er sich abschottete, für immer weniger zugänglich wurde, damit musste sie alleine fertig werden, denn niemand, auch nicht ihre einzige Freundin Sara, sollte etwas von den häuslichen Problemen erfahren.
Die zentrale Handlung setzt 23 Jahre nach des Vaters Verschwinden ein. Ida, jetzt 36 Jahre alt, hat sich ein Leben außerhalb Siziliens aufgebaut. Sie schreibt Geschichten für einen Radiosender in Rom, wo sie mit Pietro, ihrem einfühlsamen, verständnisvollen Ehemann zusammenlebt. Wie bereits bei Sara, die sich damals aus eigenem Antrieb für den leeren Sitzplatz neben dem isolierten Mädchen entschied und dafür Idas Freundschaft erhielt, gründeten all ihre Beziehungen »auf Dankbarkeit dafür, dass jemand meine Abgründe erahnte«.
Nun reißt ein Anruf der Mutter alte Wunden auf. Sie will sich von dem Haus in Messina trennen und es dazu in Schuss bringen. Ida möge umgehend anreisen und ihre persönlichen Dinge ausräumen. In der Nacht vor ihrer Abreise quält Ida ein Albtraum: Sie sieht sich langsam im Meer ertrinken. Damit tritt erneut das Motiv des Wassers auf, das in verschiedenen Formen wiederkehrt und auf den Selbstmord des Vaters, der wohl »ins Wasser zurückgekehrt war«, verweist.
Zurück im elterlichen Haus drängt sich machtvoll die Vergangenheit auf. Im unverändert belassenen Kinderzimmer erinnert sich Ida auch an Schönes, wie »die Geschichte des Weidenkorbes, in dem meine Eltern mich als Säugling aus dem Krankenhaus nach Hause getragen hatten«, aber ihre Traumata gewinnen die Oberhand. Ida hat das Gefühl, im eigenen Bett zu ersticken, an dem »Staub«, den »Milben«, dem »Asthma«, der »Angst«, »eingezwängt in der Finsternis zwischen den Puppen ihrer Kindheit«, »festgekettet an den Dingen, die wir nicht fortwarfen. Wir bewahrten alles auf, nicht um der Vergangenheit zu gedenken, sondern um die Zukunft gnädig zu stimmen«. In feinen, präzisen Beschreibungen arbeitet Nadia Terranova die Emotionen ihrer Protagonistin heraus, deren Vater sie verließ und der sie doch in allen Sphären »tyrannisiert«. »Wenn wir ihn gerade zu vergessen suchten, sprang er uns aus dem Kühlschrank an, aus der Schublade mit den abgelaufenen Medikamenten, setzte sich vor uns an den gedeckten Tisch. […] Mein Vater wachte über das Haus wie ein Aufseher«.
Idas Verhältnis zu ihrer Mutter ist komplex und schwer belastet. Sie hält sie für gefühlskalt, glaubte sich nie von ihr geliebt und trägt bis in die Gegenwart Wut auf sie im Herzen. Die inzwischen bald siebzigjährige Mutter fühlt sich ihrerseits zutiefst unverstanden. Sie ist überzeugt, damals ihr Bestes gegeben zu haben, um die Familie als Alleinverdienerin unter schwierigen Umständen durchzubringen. Dabei war sie als Ehefrau und Mutter sterbensunglücklich (»Dein Vater hat mich ruiniert.«). In einer vergifteten Auseinandersetzung der beiden Frauen wirft sie Ida ihre Kinderlosigkeit und blanken Egoismus vor, aber die Entgegnungen der Tochter erträgt sie nicht. Auch Ida hat ja die vergangenen Jahre nie nutzen können, um ihre Erlebnisse zu verarbeiten. Stattdessen entwickelte sie Fantasien, die sie mehr und mehr herunterziehen. Sie fürchtet, selber die schreckliche Krankheit in sich zu tragen. Sie begegnet dem verschwundenen Vater in ihrer eigenen Gedankenwelt.
All diese schmerzhaften Entwicklungen und zerstörerischen Gespräche, insbesondere die diffizile, vielschichtig gebrochene Mutter-Tochter-Konstellation seziert die Erzählerin schonungslos und tiefgreifend. »Es heißt, eine Mutter gibt alles und verlangt nichts. Und niemand sagt dir, dass sie in Wirklichkeit alles von dir verlangt und dir das gibt, worum du nicht gebeten hast. […] Ich war die Zielscheibe ihrer Wut, aber nicht die Ursache, weshalb meine Versuche, sie zu besänftigen, immer ins Leere laufen mussten.« Auffällig die Gewaltmetaphorik: »Kriegslist«, »eine Gruppe Überlebender der jeweils eigenen Schlacht«.
Nadia Terranova überzeugt besonders in kommunikativen Konfliktsituationen, wenn Erlebtes vor verschiedenen Hintergründen aus unterschiedlicher Perspektive konfrontativ verarbeitet wird. So wird deutlich und nachvollziehbar, dass Ida mit ihrer Mutter kaum Frieden schließen kann, weil der Weg zwischen ihnen von den Trümmern ihrer verletzten Emotionen und missglückten Erfahrungen verstellt ist. Es ist zu spät, um seit Jahrzehnten Totgeschwiegenes freizulegen, Unausgesprochenes zu offenbaren, Unverstandenes zu klären, Erlittenes zu heilen. Gerade »um unsere Ehen spannte sich ein besonnenes, bilaterales Gesetz des Schweigens«. Jetzt bricht alles hervor wie aus einem Vulkan.
Ähnlich einer Psychoanalytikerin hat Nadia Terranova Idas vermeintlich ausweglose, schuld- und schmerzbehaftete Lebenssituation in deutlicher, bildhafter Sprache erfasst. Wenn die Protagonistin ihren wenigen schönen Erinnerungen nachgeht, schaffen bisweilen poetische Passagen Erleichterung in einem insgesamt sehr ernsten Roman. Er war 2019 unter den Finalisten des Premio Strega, des wichtigsten italienischen Literaturpreises.
 · Herkunft:
· Herkunft:  · Region: Sizilien
· Region: Sizilien