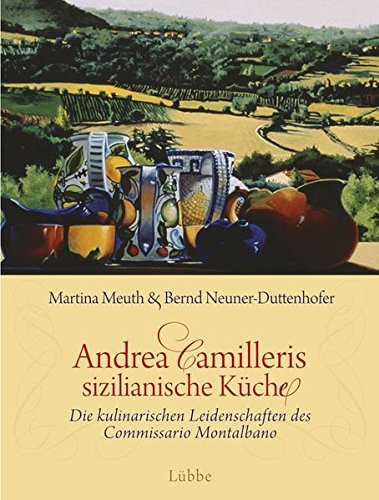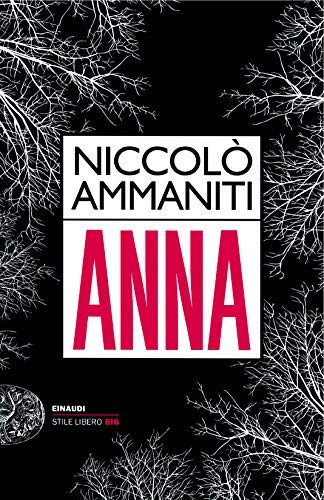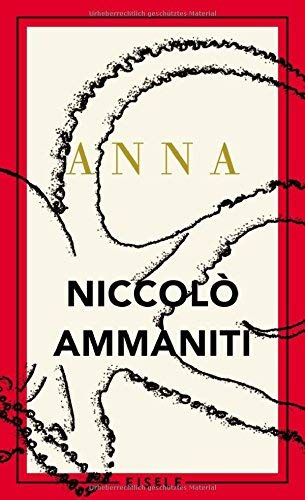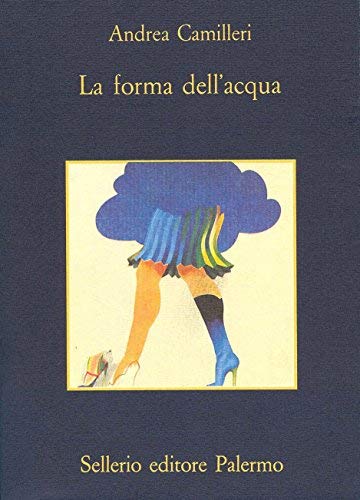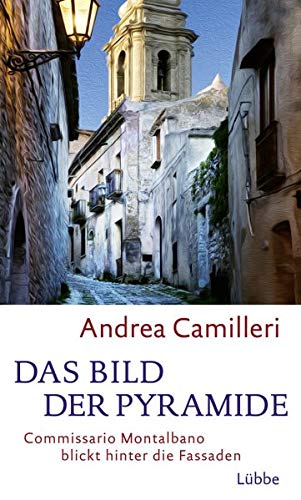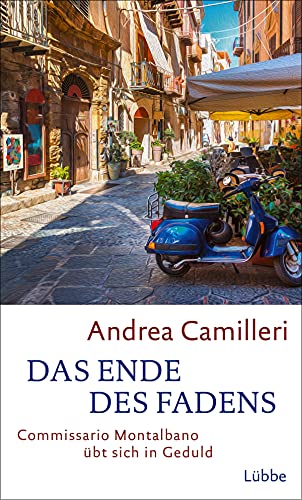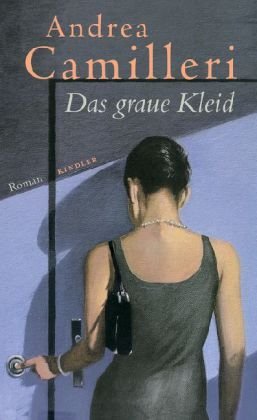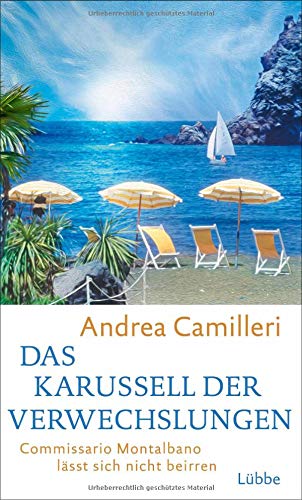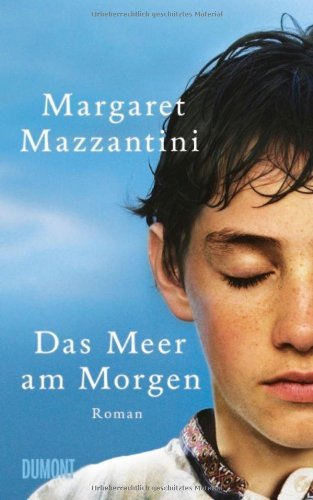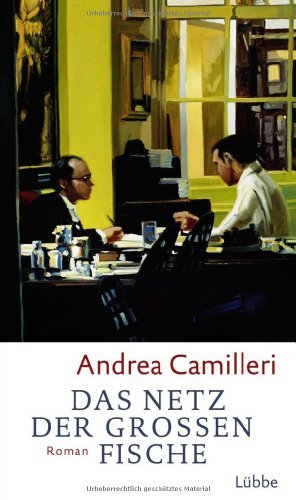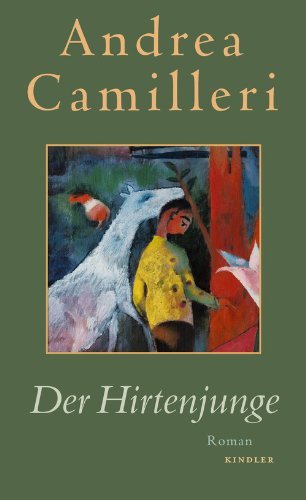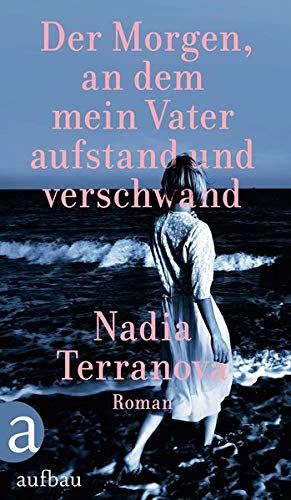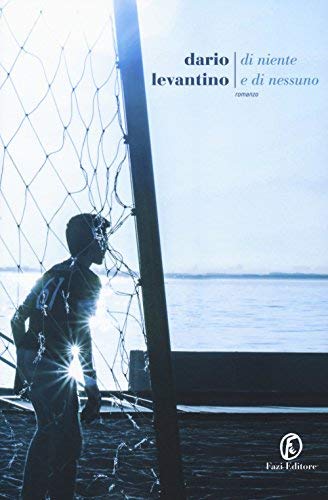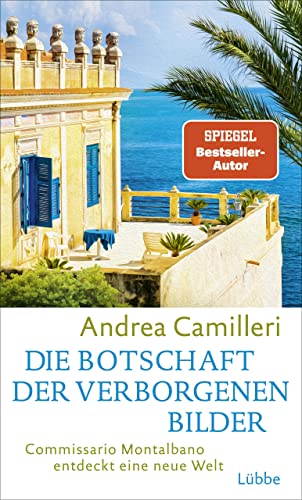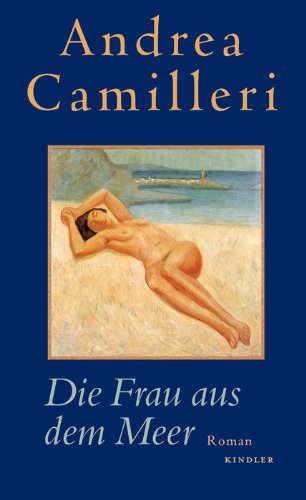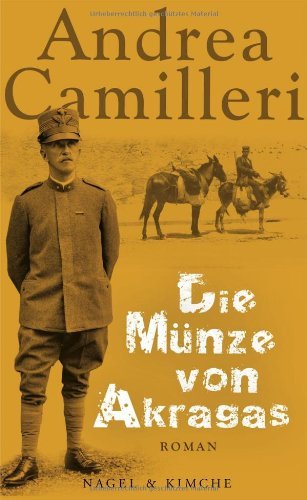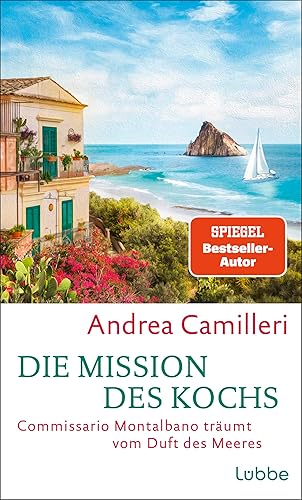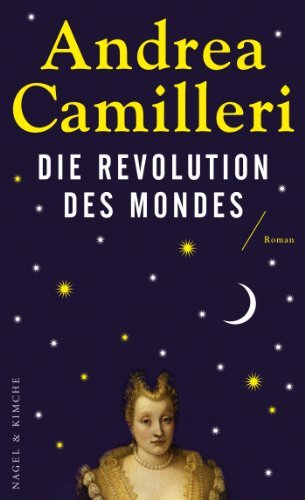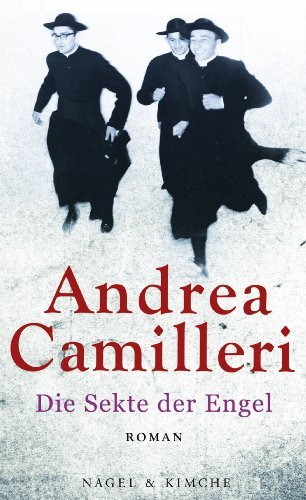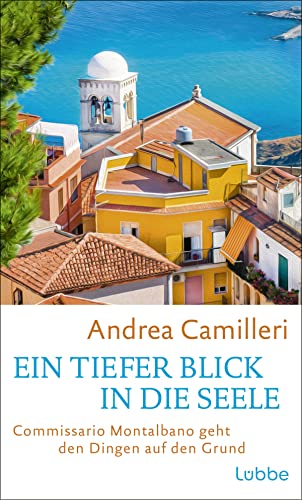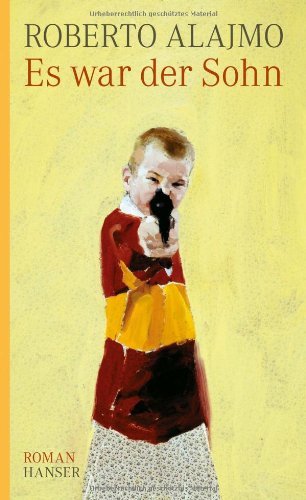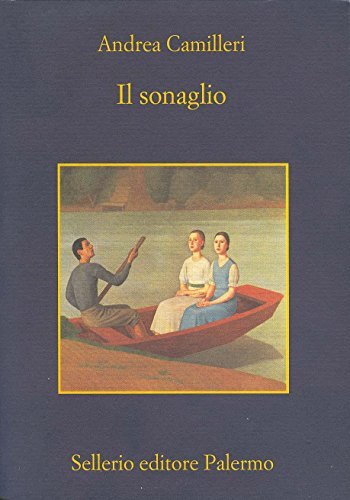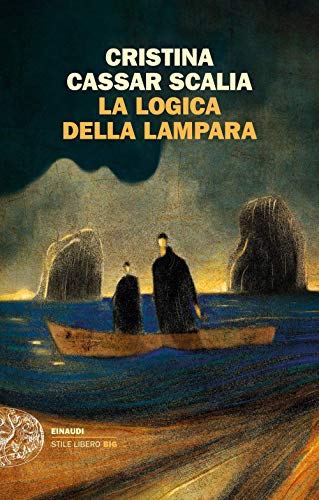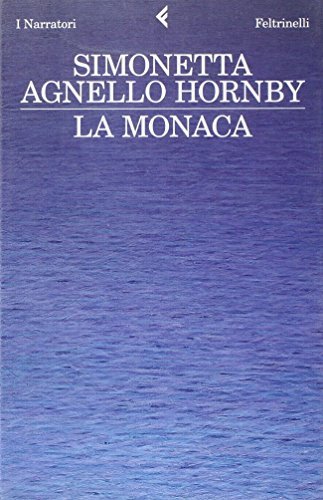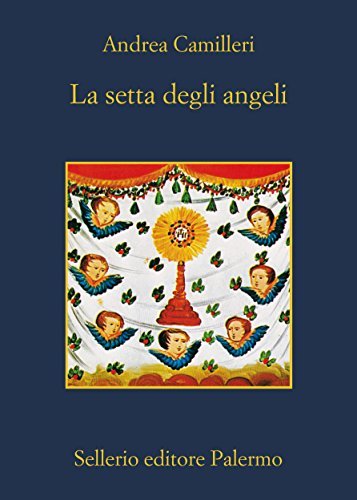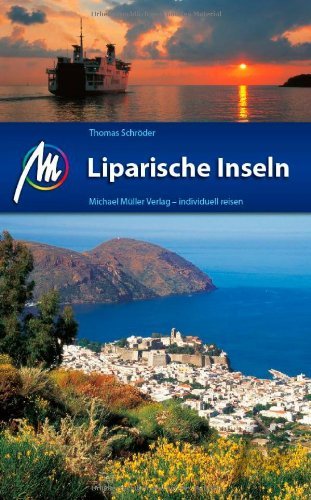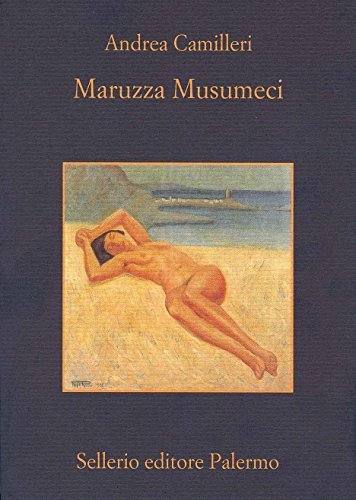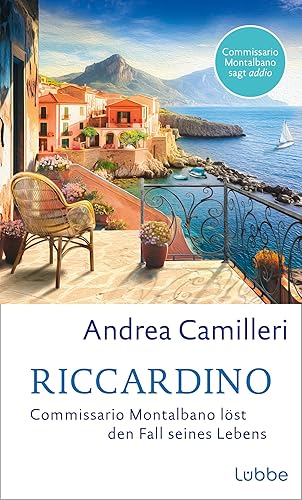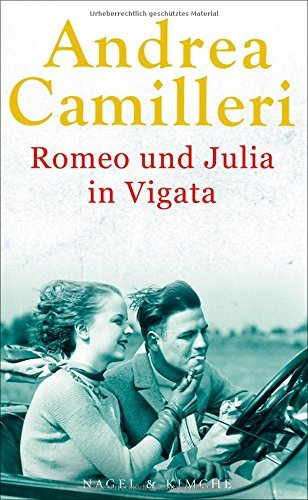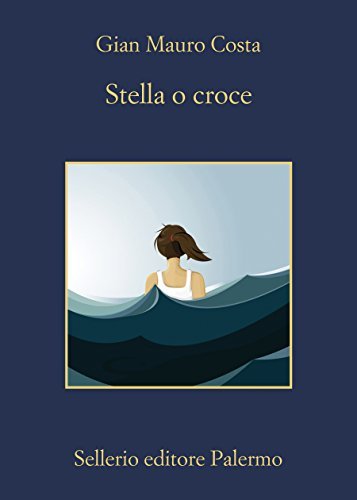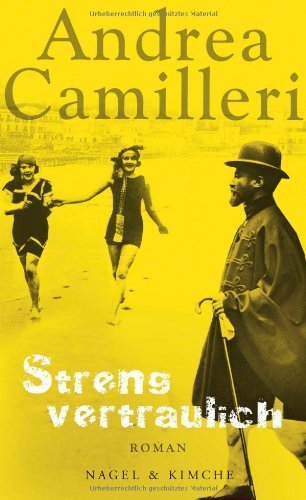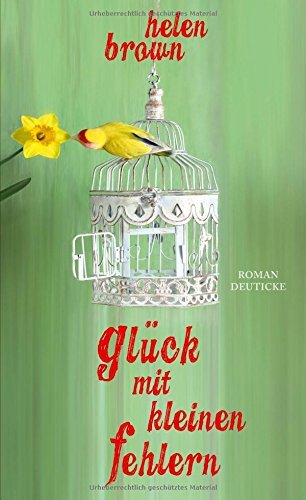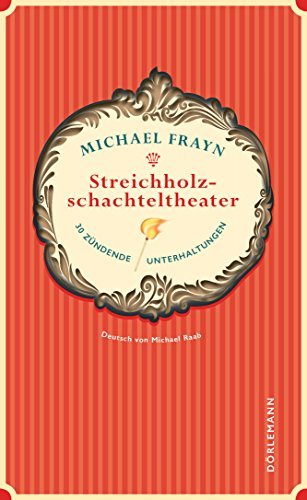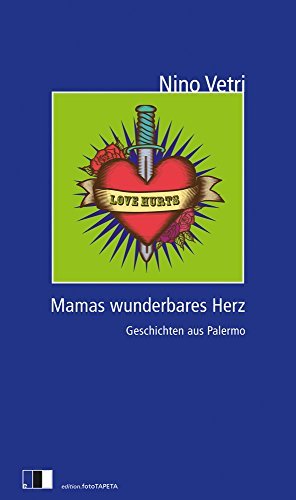
Schöne Löcher in den Mauern
Wer je durch Italien gereist ist, kennt sie: jene Rohbauten aus Betondecken, dazwischen ein paar dünne Zementsäulen, aus denen rostige Armierungsstähle sprießen. Jahrelang können sie halbfertig im Nirgendwo ausharren, bis der Eigentümer wieder etwas Geld, Zeit und Material beisammen hat und nach und nach rote Ziegelsteinwände das Nichts zwischen den schwebenden Geschossdecken zu richtigen Stockwerken wandeln.
Bald wird der (namenlose) Erzähler, neun Jahre alt, aus einem Wohnblock in Palermo in eine neue Wohnung draußen vor der Stadt ziehen, wo das Bauland billig ist. Vorerst steht dort, im Viertel Michelangelo, aber nur eine »Pfahlbau-Ansiedlung« auf der grünen Wiese. Jeden Tag fährt die Familie hin, um ihre imaginäre Wohnung zu besiedeln und auszuprobieren, wo die Wände, Türen, Fenster und Möbel einmal wachsen sollen.
Der gewitzte, fantasievolle Junge findet hier ein Paradies auf »jungfräulichem Territorium«, bevölkert von seltenen Tieren. Wenn er es mit seinen Kumpels durchstreift, fühlen sie sich mal wie amerikanische Pioniere oder Afrika-Forscher, mal wie Normannen im Kampf gegen die Araber, wie Garibaldini oder Weltkriegssoldaten. Am Abend prallt »Genosse General« unsanft auf die Zivilisation. Mama versucht ihn in einem Bottich aus seiner Ritterrüstung aus trockenem Lehm und Fahrradfett zu schälen, Wasserschwälle begleitet von verzweifelten Schimpftiraden wegen der ruinierten Hosen.
Viele, die hier wohnen, sind schräge Charaktere. Der Erzähler beobachtet sie und lernt von ihnen. Der »vierschrötige« Carabiniere, der den »spindeldürren« immer auf den Arm nimmt. Der alte Mann mit Garten, der Obst und Gemüse aufs Gramm genau verkauft und dazu keine Waage braucht. Der misstrauische »Flüchtige«, der jede Frage mit einer absurden Gegenfrage in so gereiztem Ton kontert, dass sie jeden abblitzen lässt. »Man grüßte ihn, und er: ›Kennen wir uns?‹ Man grüßte ihn nicht, und er: ›Gegrüßt wird nicht mehr?‹« Sein Bruder ist dagegen »nett und ordentlich und gut erzogen«, »ein braver Mann« mit einem unauffälligen weißen Fiat, und er scheint sich zu schämen für den »Flüchtigen«.
Natürlich ist dieser Ort weder Paradies noch jungfräulich. In der trostlosen Gegend »am Arsch der Welt« gibt es keine Straßen, keinen Supermarkt, keine Pfarrei. Ab und zu kommt sonntags ein Priester in die Diaspora geradelt, eine »Art Missionar« in Tropenjacke über dem Talar. Wahrscheinlich wäre er »lieber in den Kongo gegangen, der Missionar.«
Im Michelangelo ist nichts, wie es anmutet. Die verzauberten Parks von Prinzen und Emiren sind eine verfallene Wüstenei, wo Hütten und Kriegsrelikte verrotten und im Frühling »sogar die Exkremente wieder aufzublühen« scheinen. Wenn man zur »Fußgängerzone« spaziert, meint man eine der öden Straßen, auf die sich kaum je ein Auto verirrt. Ist es ein Polizeiwagen, ertönt an der Bar (eine ehemalige »Garage aus Tuffsteinwürfeln«) der obligatorische scharfe Pfiff, und manch einer macht sich still davon. Der »Flüchtige« (»Wie viele Hühner hast du geklaut?«, provoziert ihn der Carabiniere) bleibt als einziger seelenruhig stehen – »ein armer Teufel, der keiner Fliege etwas zuleide getan hätte«. Sein »braver Bruder«, »der Vorzeige-Angestellte«, ist hingegen »einer der Verbrecherbosse der Gegend«.
In Italiens Süden liegen Sonnen- und Schattenseiten nah beisammen, insbesondere in Sizilien, und in seinen Städten am allerdichtesten. Barocker Prunk – zerbröckelnd; stolze Reste antiker Größe – in den Straßen gehäufter Müll; gewaltige Kirchen – daneben düstere Einzimmer-Bassi; weite Strände – dahinter rostende Industrieruinen; fotogene Armut, pittoresker Verfall. Ausgelassene Lebensfreude und überwältigende Gastfreundschaft – unbarmherzige Aktionen des organisierten Verbrechens.
Ein hübsches Symbol für die palermitanischen Paradoxe ist das Herz, das den Titel gibt und das Cover ziert – ein populäres Emblem zwischen Erotik und Religion. Die Jungen treffen einen Arbeiter »mit einem enormen Kreuz und einem enormen Bizeps«. Was lässt so ein Bär auf seinen Oberarm tätowieren? »Mamas Herz«, in Bild und Worten. Der Erzähler ist gerührt: Beim Nägeleinhämmern »schien das Herz zu schlagen. Es schlug für seine Mama. Wie sollte so einer dir Angst machen?« Und wo macht man so schöne Tattoos? »Im Knast.«
Die Kluft zwischen all diesen Gegensätzen überbrückt der Junge durch seine blühende Erzählkunst. Er lässt einfach beides verschmelzen, das Hässliche und Böse löst sich in der Poesie auf. Diese Strategie ist, wie die Gegenfrage-Marotte, ein persönlicher Schutzpanzer. Am Abend wartet nicht nur die Mutter, sondern auch der wütende Vater (»Überall haben wir euch gesucht! Mit dem Gürtel kriegst Du's!«). Kaum hebt er die Hand, um dem Filius eine Tracht Prügel zu versetzen, beginnt der Knabe eifrig zu fabulieren, was für Wunder er heute gesehen, welche Heldentaten er vollbracht habe. Wie der Zeiger eines alten Manometers verharrt der väterliche Arm so lange in der Höhe, wie die faszinierende Schilderung ihn trägt. Lässt die Fantasie nach oder schweigt er einen Moment, nähert sich die bedrohliche Hand; versiegt seine Poesieproduktion schließlich, sinkt der strafende Arm am Ende doch noch herab – trotz der Anerkennung, die der Vater seinem »Scheherazade«-Sohn unverhohlen zollt.
Im Michelangelo lernt der Junge, was er später im Leben vertiefen wird: »Man macht einen auf Hanswurst und stellt sich dumm um zu überleben.« Wo Verwechslung, Täuschung, Mimikry, Konfusion zum Prinzip werden, schlägt am Ende sogar die Fantasie in Wahrheit um (oder umgekehrt?). Der Vater fordert ein Geständnis wegen zerschundener Knie ein, doch weil der Sohn einen schlechten Tag hat, tischt er ihm ausnahmsweise die Wahrheit auf; die jedoch ist so fantastisch, dass der Vater sie für eine gut erfundene Räuberpistole hält ... Fortan bleibt die Ungewissheit, was man glauben kann und was nicht.
Die erste Geschichte endet mit dem Ende der Romantik. Der »Pfahlbau« wird fertiggestellt, die Stadt rückt in Gestalt von Straßen, Supermarkt, neuen Wohnblocks näher, das Abenteuerterrain verkommt zu kläglichen Inselchen, die folkloristischen Charaktertypen setzen sich ab.
In seiner zweiten Geschichte ist der Erzähler, nunmehr Student, in ein finsteres Viertel der Stadt gezogen, ein Ghetto in ständiger Gärung, dessen Bewohner (»gestaltlose Wesen«) an Mäuse oder auch den »Golem« erinnern. Wieder erlebt er eine unsichere Realität und fragliche Wahrheiten. Da gibt es die Paradoxie der Ehrenpräsidenten einer frommen Kongregation, die frisch aus dem Gefängnis entlassen wurden oder noch einsitzen, und die des fliegenden Händlers, den man den »Giftmischer« nennt, weil er verdorbenes Zeug verkauft – weil jedoch niemals im eigenen Viertel oder an Freunde von »Onkel Mario«, ist er im gleichen Atemzug »ein ehrlicher Mann«. Viele Bewohner stellen sich mit Name und einer Ziffer vor: »Ich bin Luigi, 640b.« Es sind die Strafgesetzbuchparagraphen ihrer Verurteilungen, die sie stolz wie »Adelstitel« führen. »Im Endeffekt ist manches, was dir wie ein Paradies erscheint, die Hölle, und umgekehrt.«
Nach diesem Bildungsweg folgt als dritte und längste Geschichte ein groteskes Roadmovie durch ein surrealistisch verfremdetes Palermo, ein Protokoll über genau 24 Stunden, die der Erzähler mit seinem Freund, dem »Genie«, durch die Stadt irrlichtert. Unmäßig viel Alkohol vernebelt ihre Sinne, lässt sie vom Boden abheben, macht ihnen wüste Träume. Es verschlägt sie auf Plätze, in Gassen, Bars, zu barocken Brunnen und Kirchen. Schwankende Gestalten nähern sich und verschwinden wieder: der dubiose »Alte«, Hühnchen bratende »Nigerianer«, zahnlose »Odalisken«, irische Sagengestalten, ein apokalyptischer Prediger, der seine Gemeinde gern »für den Rest eurer Tage in der Zelle vermodern lassen« würde; er erteilt den »Nichtsnutzen« und »feigen Wiederholungstätern« seinen Segen, aber »keine Absolution«.
Unablässig prasseln Fetzen von Lebensanschauungen, Kulturkritik, Fakten, Beobachtungen, Gewissheiten und Zweifel auf den Erzähler ein, der in seiner Unentschiedenheit nichts entgegenzusetzen hat, fühlt er sich doch selbst als »Loch in der Mauer«. »Große Verpflichtungen im Leben können wir nicht übernehmen«, räumt er bedauernd ein. Es reicht gerade noch dazu, einen Gelegenheitsjob anzunehmen – einen kafkaesken Botengang.
Am Ende ist die Wirklichkeit nur noch ein Vexierbild, ein fragwürdiges Zwischenreich: »Sag mal, kann das Lamm sich beim Wolf ausruhen?«
Der grandiose Fabulierer Nino Vetri hat bisher vier Bücher geschrieben; sie werden bei Sellerio und der Edition.fotoTAPETA verlegt:
»Le ultime ore dei miei occhiali« (2007)  [»Die letzten Stunden meiner Brille« (2011)
[»Die letzten Stunden meiner Brille« (2011)  , übersetzt von Adelheid Mittorp]
, übersetzt von Adelheid Mittorp]
»Lume lume« (2010)  [»Lume lume« (2013)
[»Lume lume« (2013)  , übersetzt von Andreas Rostek]
, übersetzt von Andreas Rostek]
»Sufficit« (2012)  [noch nicht übersetzt]
[noch nicht übersetzt]
»Il Michelangelo« (erscheint demnächst) [»Mamas wunderbares Herz« (2015)  , übersetzt von Andreas Rostek].
, übersetzt von Andreas Rostek].
Nino Vetri ist außerdem als Saxophonist erfolgreich. Seine Gruppe »La Banda di Palermo« vibriert zwischen traditioneller palermitanischer Blasmusik und Punk – hörenswert!
 · Herkunft:
· Herkunft:  · Region: Sizilien
· Region: Sizilien