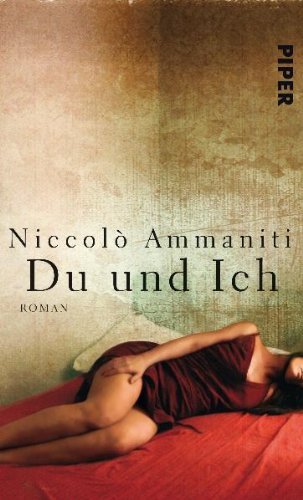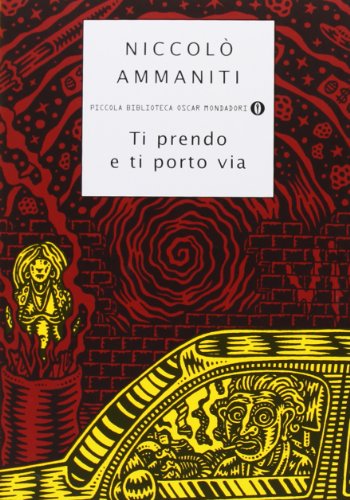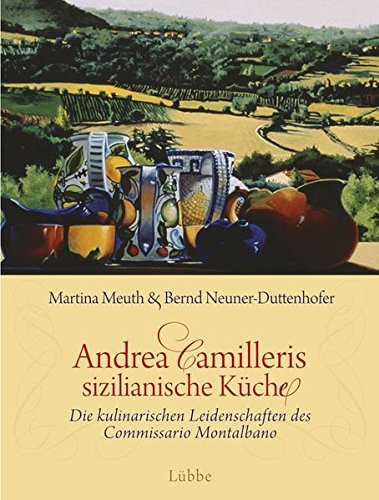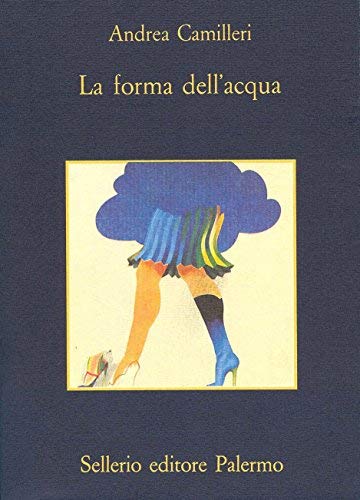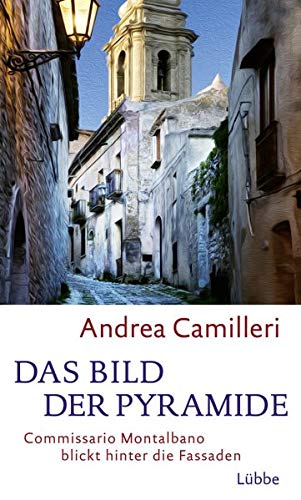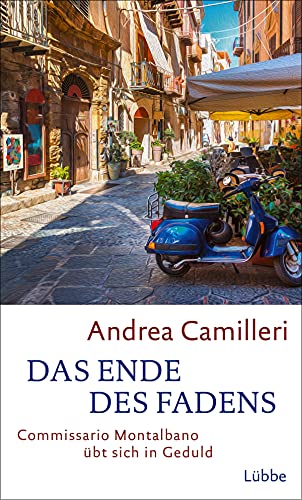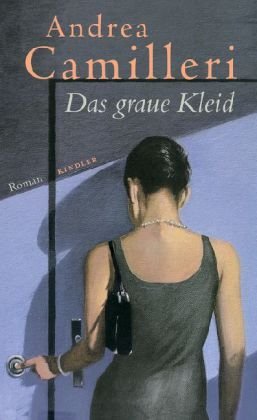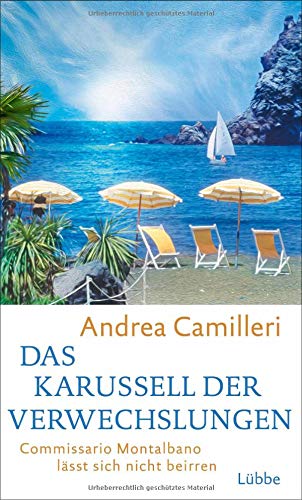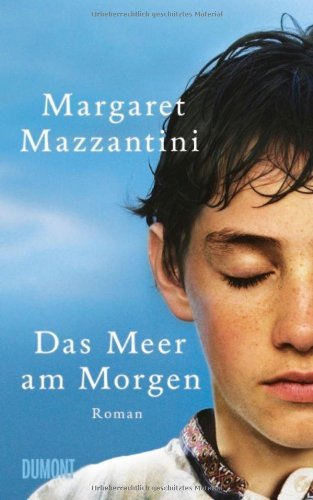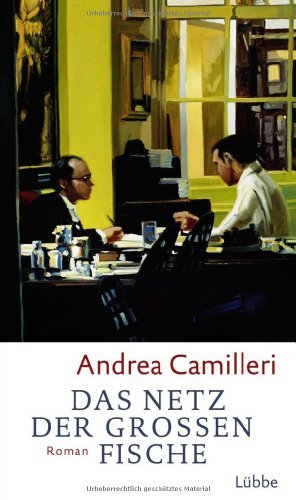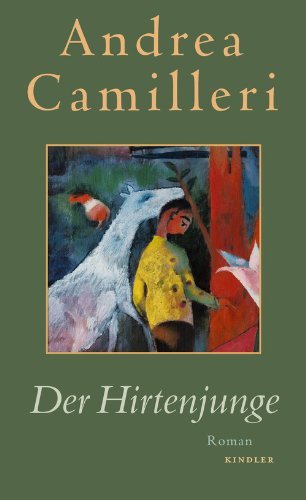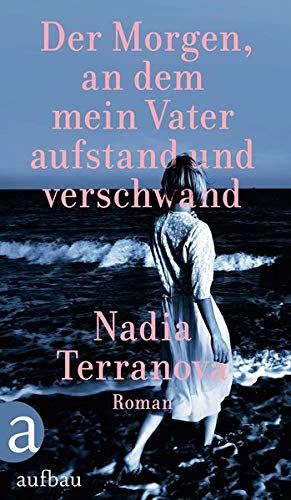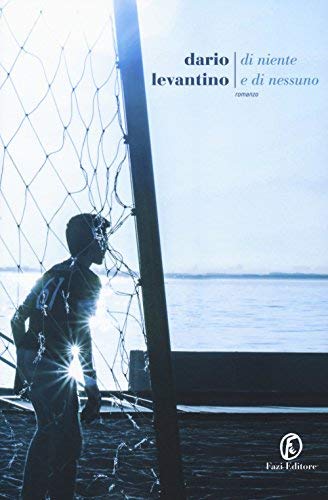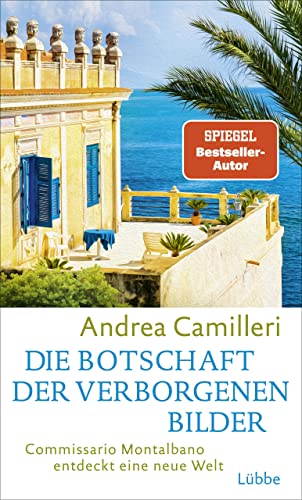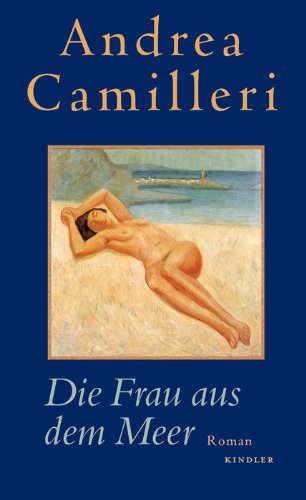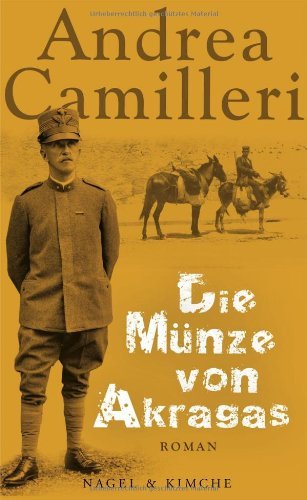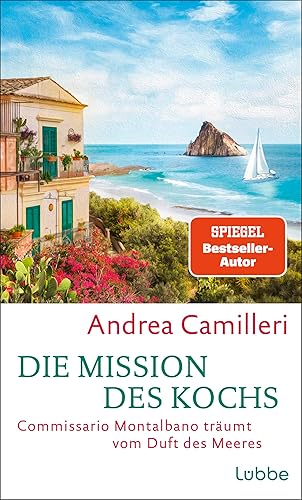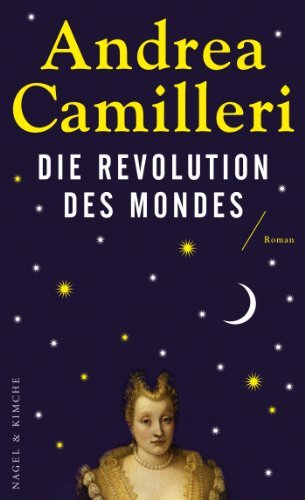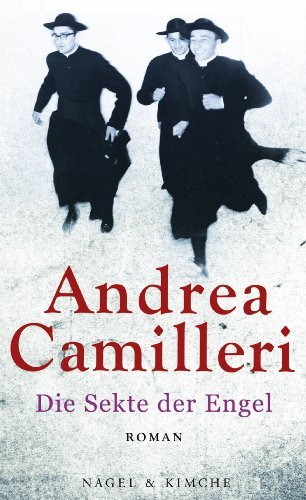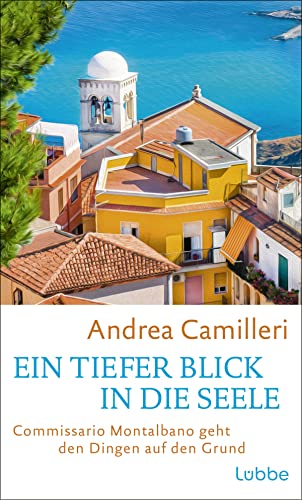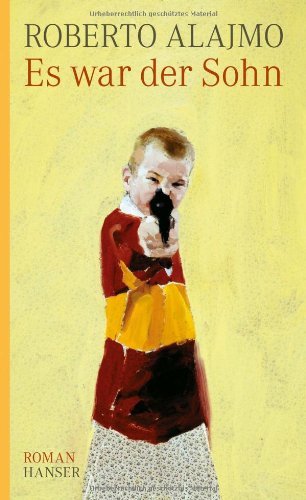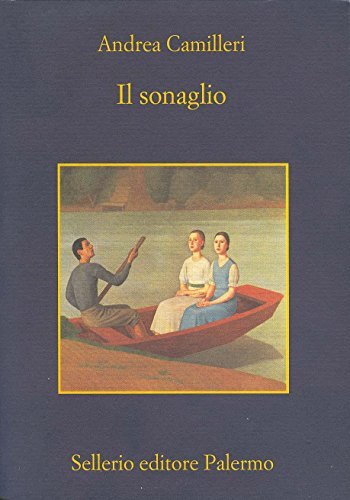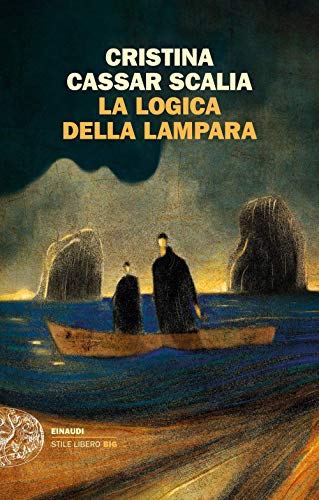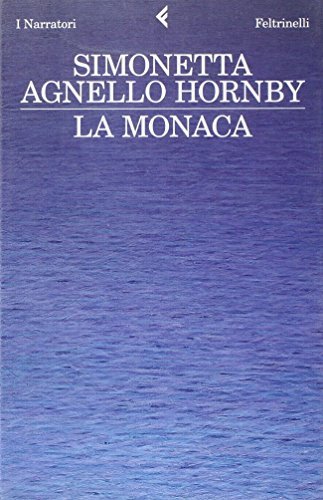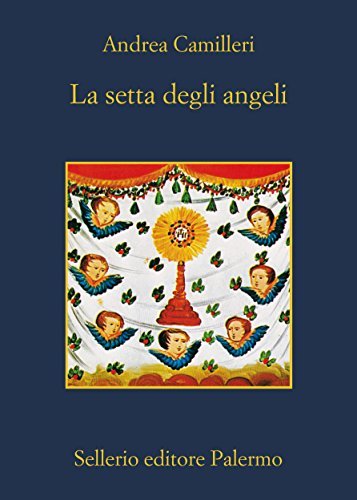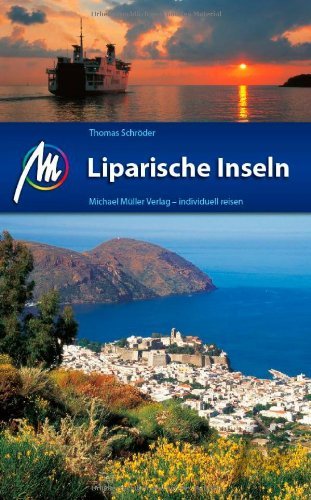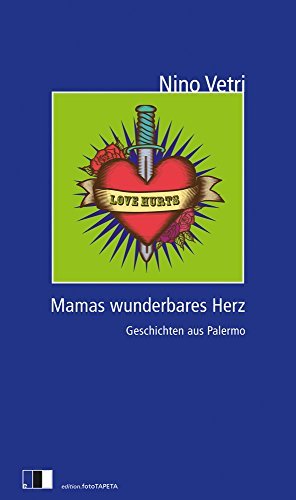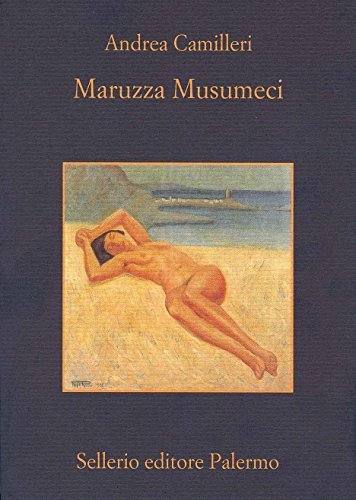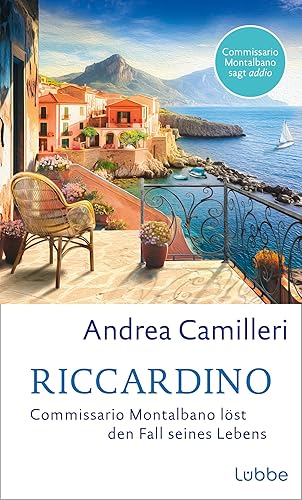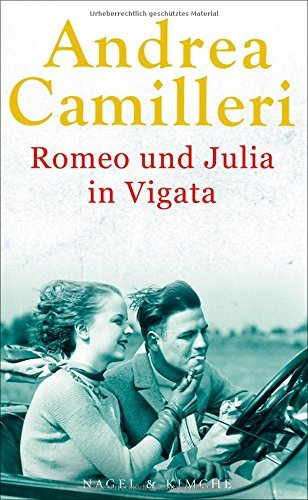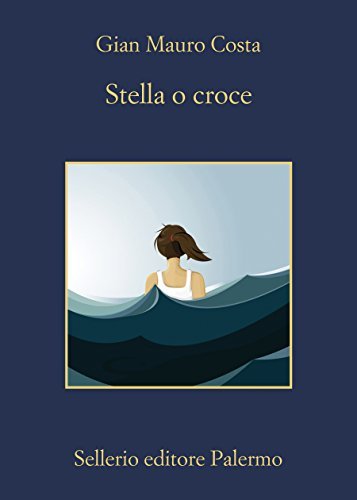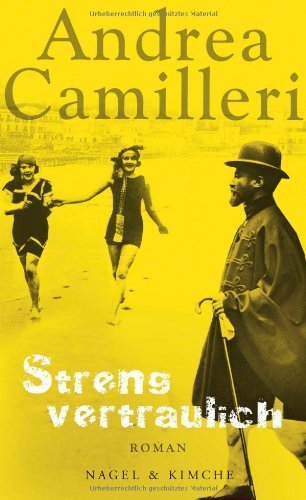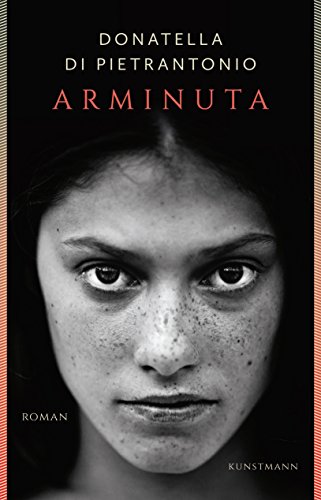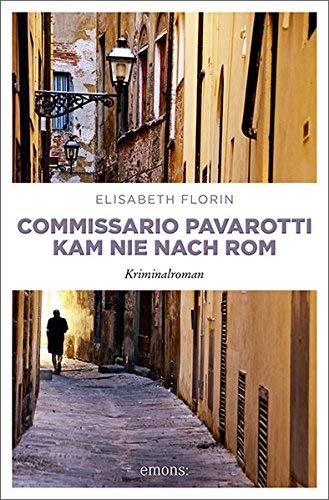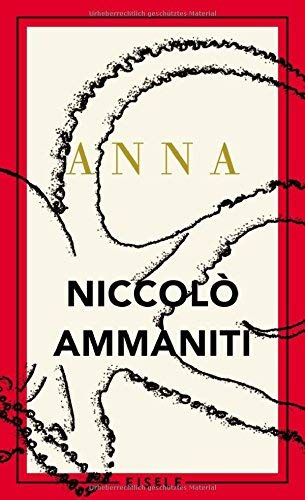
Anna
von Niccolò Ammaniti
Seit vier Jahren hat eine Seuche alle Erwachsenen dahingerafft, Kinder leben nur bis zur Pubertät. Die Reste menschlicher Zivilisation gehen ihrem Ende entgegen. In dieser Dystopie schlägt sich eine Dreizehnjährige mit ihrem kleinen Bruder durch ein verwüstetes Sizilien.
Abenteuer im apokalyptischen Niemandsland
Anna ist dreizehn. Das bedeutet: Bald muss sie sterben – wie alle Kinder. Der Virus, der 2016 in Belgien erstmals auftrat und sich rasant über die Welt verbreitete, wirkt offenbar über Hormone, die nur Erwachsene besitzen. Deshalb sind alle »Großen« längst gestorben, während den Kindern eine Schonfrist bleibt. Ganz auf sich gestellt, schlagen sie sich seit mittlerweile vier Jahren allein, in Grüppchen oder organisierten Banden durch die Ruinen unserer Zivilisation. Mit dem Eintritt in die Pubertät zeigen sich bald rote Flecken auf dem Körper, und dann rafft »die Rote Seuche« auch sie binnen einiger Tage, höchstens Wochen dahin. Das Ende der Menschheit ist absehbar.
Oder gibt es doch irgendwo überlebende Erwachsene? Gerüchte über eingebunkerte Forscher oder Magier kursieren überall. Dieser Hoffnung folgt Anna, sie lässt ihr elterliches Haus bei Castellammare del Golfo (westlich von Palermo) hinter sich, läuft Richtung Messina, um irgendwie die Meerenge zu überwinden und auf dem Festland nach Rettung zu suchen.
Anna muss ihr eigenes Überleben sichern (Nahrung und Schlafplätze finden, verwilderte Tiere und verrohte Altersgenossen abwehren), täglich lebenswichtige Entscheidungen treffen. Der Tod gehört zu ihrem Leben: sterbende Jugendliche, verwesende Körper, das Wissen um ihre eigene Endlichkeit. Dazu trägt sie Verantwortung für Astor, ihren kleinen Bruder von ungefähr sechs Jahren. Orientierung und Rückhalt gibt ihr in allem ein Schulheft, in dem ihr die weitsichtige, belesene Mutter vor ihrem Tod alles über »Wichtige Dinge« aufgeschrieben hat. Die Kapitel vermitteln medizinisches Grundwissen und Ratschläge für alle möglichen Lebenslagen, denen die Kinder ausgesetzt sein werden. Vor allem schenkt sie ihnen Vertrauen und Zuversicht (»Ihr seid klug und tüchtig, und ich bin sicher, dass Ihr das schafft … Das Wichtigste wird sein, dass Ihr immer Euren Kopf benutzt.«).
Niccolò Ammaniti hat in seinem jüngsten Roman erneut ein Kind an der Schwelle zur Erwachsenenwelt als Protagonisten gewählt – zum ersten Mal ein Mädchen. Anders als ihre Vorgänger Michele (in »Ich hab keine Angst« [› Rezension]) und Cristiano (in »Wie es Gott gefällt« [› Rezension]) steht sie nicht unter dem direkten Einfluss fragwürdiger Erwachsenencharaktere. Über die Leitlinien ihrer Mutter und die Verpflichtung für Astor hinaus ist Anna ungebunden wie all ihre Gleichaltrigen.
Wie bewähren sich Kinder ohne erwachsene Lotsen, ohne die Segnungen der Zivilisation, nachdem der Firnis europäischer Kultur im Kampf ums nackte Überleben schnell abgewetzt ist? Die spannende Ausgangssituation erinnert an große Vorbilder. William Golding hat in »Lord of the Flies« eine ähnliche Laborquarantäne geschaffen, indem er einen englischen Knabenchor auf einem unbewohnten Inselparadies abstürzen ließ. Vernunft und Moral scheitern dort kläglich an Irrationalität und Gewalt. Setzt Ammaniti mit sizilianischen Kindern ein optimistischeres Menschenbild dagegen? Oder will er uns vor Augen führen, welche Weichen wir heute stellen müssen, damit unseren Kindern eine Zukunft wie Annas erspart bleibt?
Dergleichen Tiefgründiges wäre untypisch für den Autor. Ammaniti war immer brillanter Fabulierer, aber kein Programmatiker. »Anna« ist Abenteuerroman auf Dystopie-Basis und Road Movie, und das mag ja auch genügen für ein gutes Buch. Die Reise der Protagonistin taugt indes nicht einmal als Metapher, denn sie wandelt sich kaum während ihrer Wanderungen von Szene zu Szene. Erkenntnisse bleiben banal: »Wir müssen weitermachen, ohne zurückzublicken, weil wir die Energie, die uns durchdringt, nicht beherrschen können, und selbst verzweifelt, verstümmelt und blind ernähren wir uns weiter, schlafen und schwimmen gegen den Strudel an, der uns nach unten zieht.«
Nichtsdestoweniger ist packend erzählt, was Anna und ihr Bruder im apokalyptischen Niemandsland erleben. Schon die Frage, ob es Anna gelingen wird, den Bruder und sich selbst trotz aller Gefahren zu retten, hält die Spannung bis zum Schluss hoch. Die Fantasie des Autors gestaltet breit und detailreich, wie sich die Kinder in ihrer todgeweihten Welt arrangieren – da gibt es (ein wenig) Freundschaft, keimende Liebe, Mitgefühl, Hilfsbereitschaft, Einfallsreichtum, vor allem aber die rücksichtslose Durchsetzung egoistischer Interessen, hemmungslose Gewalt, Bandenbildung. Der Kapitalismus blüht schon in der Kinderwelt: Der geschickte Einsatz vorgeblichen Wissens oder magischer Kräfte zieht andere an, verleiht Macht über sie, entlockt ihnen Reichtümer (hier: rare Schätze wie Batterien, Medizin und Süßigkeiten), degradiert sie zu Sklaven.
Interessant, wie sich ein Bedürfnis nach Spiritualität manifestiert. Kunstvoll verziert Anna die Knochen der Mutter und arrangiert sie im verschlossenen Elternschlafzimmer wie Reliquien, vor denen sie sich Kraft holt. Ein paar längst nutzlos gewordene Objekte symbolisieren für sie und Astor das verlorene Paradies. Um den kleinen Bruder davon abzuhalten, ihrer Protektion zu entwischen und die Umgebung auf eigene Faust zu erforschen, erfindet sie den Mythos eines bösen Gottes »Danone« (dessen Name an vergangenen Schokocreme-Luxus erinnert).
Ammanitis unkomplizierte Prosa ist lebendig, ungeheuer visuell, suggestiv und drastisch wie eh und je, muss hier aber ohne Leichtigkeit und Zynismen auskommen. Am prägendsten sind die detaillierten Beschreibungen der verfallenen, durch Gewalt, Plünderungen und Großbrände verwüsteten Szenerie. Staub und Asche überall, keine Glasscheibe ist heil, keine Wohnungstür unaufgebrochen. Dinge, die unseren Alltag bestimmen, haben jeden Wert verloren – Smartphones, Kühlschränke, Fernseher, Badezimmer, Geld. Schlangen vor sich hin rostender Autos lassen erahnen, wie Zigtausende ihrem Schicksal zu entfliehen trachteten, ehe sie einsehen mussten, dass es kein Entrinnen gab. Auf ihrer täglichen Suche nach Ess- und Trinkbarem durchkämmt Anna riesige stockfinstere Supermarkt-Hallen. Die Natur überwuchert Gebäude, Plätze und Autobahnen. Verwilderte Haus- und Nutztiere ziehen durch verödete Stadtviertel. Einem besonders verrohten Hund schenkt der Autor eine eigene Biografie. Ironischerweise wurde er einst zur Kampfbestie herangezüchtet, musste sich nach dem Tod seines Herrn von der Kette lösen und dann, endlich frei, um sein Leben kämpfen. Nachdem Anna den Machtkampf gegen ihn gewinnt und sein Leben rettet (eine der stärksten Szenen des Romans), begleitet er sie fortan treu wie ein Schutzengel. Der gemeinsame Weg von Station zu Station bestimmt die lineare Struktur der Handlung, die nicht die Sogwirkung früherer Plotkonstruktionen entfacht, wo mehrere Stränge unausweichlich auf eine Katastrophe hinzielten.
Unter den Situationen, die die beiden mit Verhaltensalternativen konfrontieren und ihnen mutige Problemlösungen abverlangen, nimmt der Aufenthalt bei einer obskuren Gemeinschaft in einem verwahrlosten Luxushotel in den Bergen viel Raum ein. Hunderte Kinder tummeln sich auf dem Gelände, Wachmannschaften kontrollieren den Zugang, ein paar Anführer scheinen die Rituale um einen grotesken Knochenkult vorzugeben. Das Gerücht, dass eine geheimnisvolle Alte Heilung bringen werde, heizt die irrationale Stimmung an, die in der Massenhysterie eines gigantischen »Feuerfestes« kulminiert. Derlei Narrenschiff-Spektakel, normalerweise ironisch-drastisch überzogen, sind Ammanitis Spezialität. Ausgerechnet in dieser Dystopie wirkt die Szene jedoch allzu künstlich, befremdlich und unnötig.
In ihrem unbarmherzigen Umfeld agiert Anna emotionslos, pragmatisch, klug und unbeirrbar – eine starke Kämpferin. Beeindruckend die Reife, mit der sie ihren Bruder für die Zeit nach ihrem eigenen Tod vorbereitet. Es sind außergewöhnliche Charaktere, die sich in einer brutalen Realität im Zeichen des Todes bewähren und mit denen wir existenzielle Erfahrungen von Freud, Leid, Gefahr und Verlust durchleben. Acht Jahre lang hat der Autor nach eigenem Bekunden an dem Stoff gefeilt. Und dennoch geht der Roman kaum tiefer unter die Haut als seine Vorgänger, in denen sich Engagement und Herz des Autors im überbordenden Fabulieren, der ironischen Note seiner Charakterzeichnungen und der amüsierten Betrachtung selbst absurdester Episoden niederschlug. Das Tragische ist wohl nicht Ammanitis Stärke.
 · Herkunft:
· Herkunft:  · Region: Sizilien
· Region: Sizilien